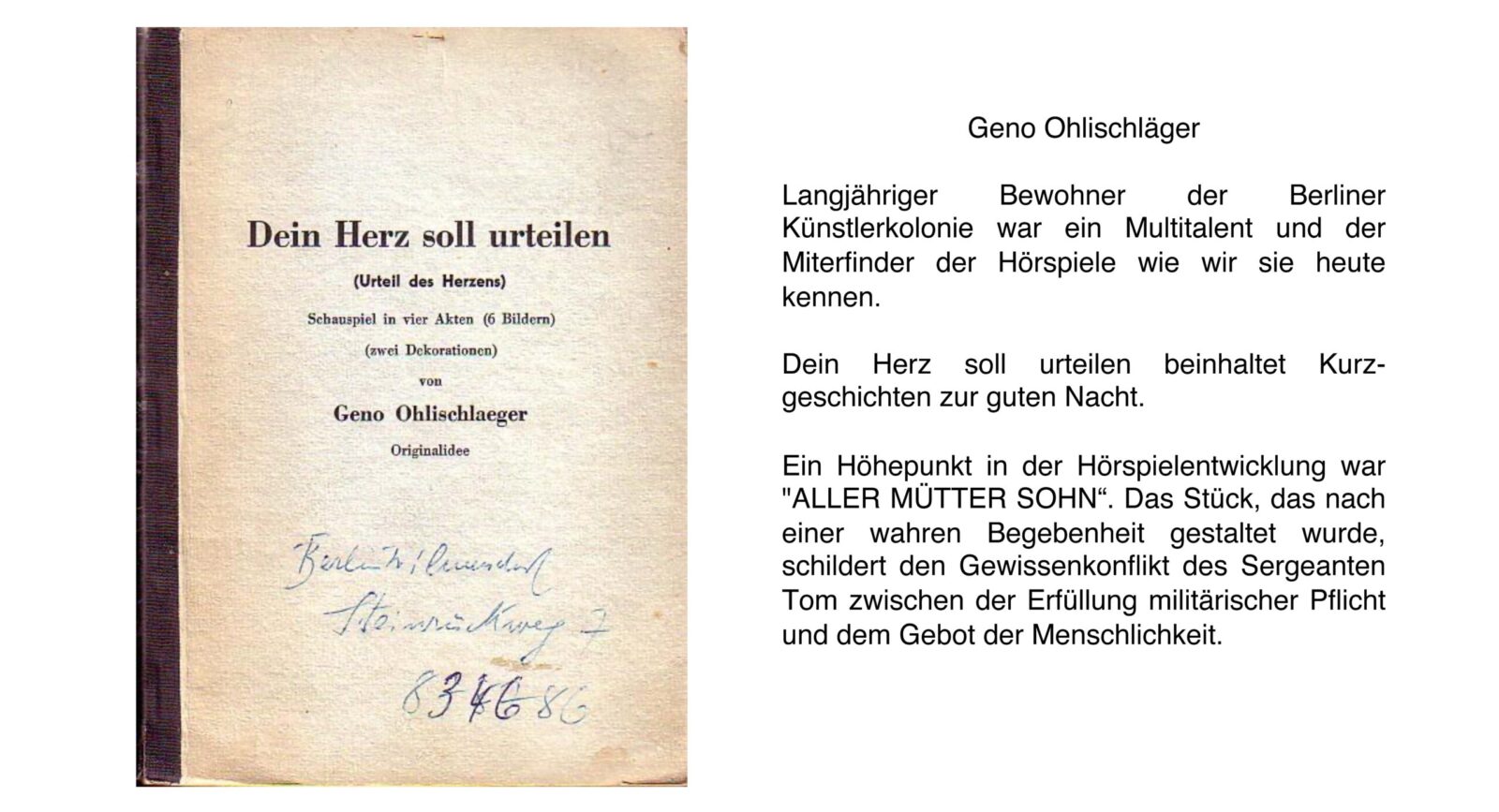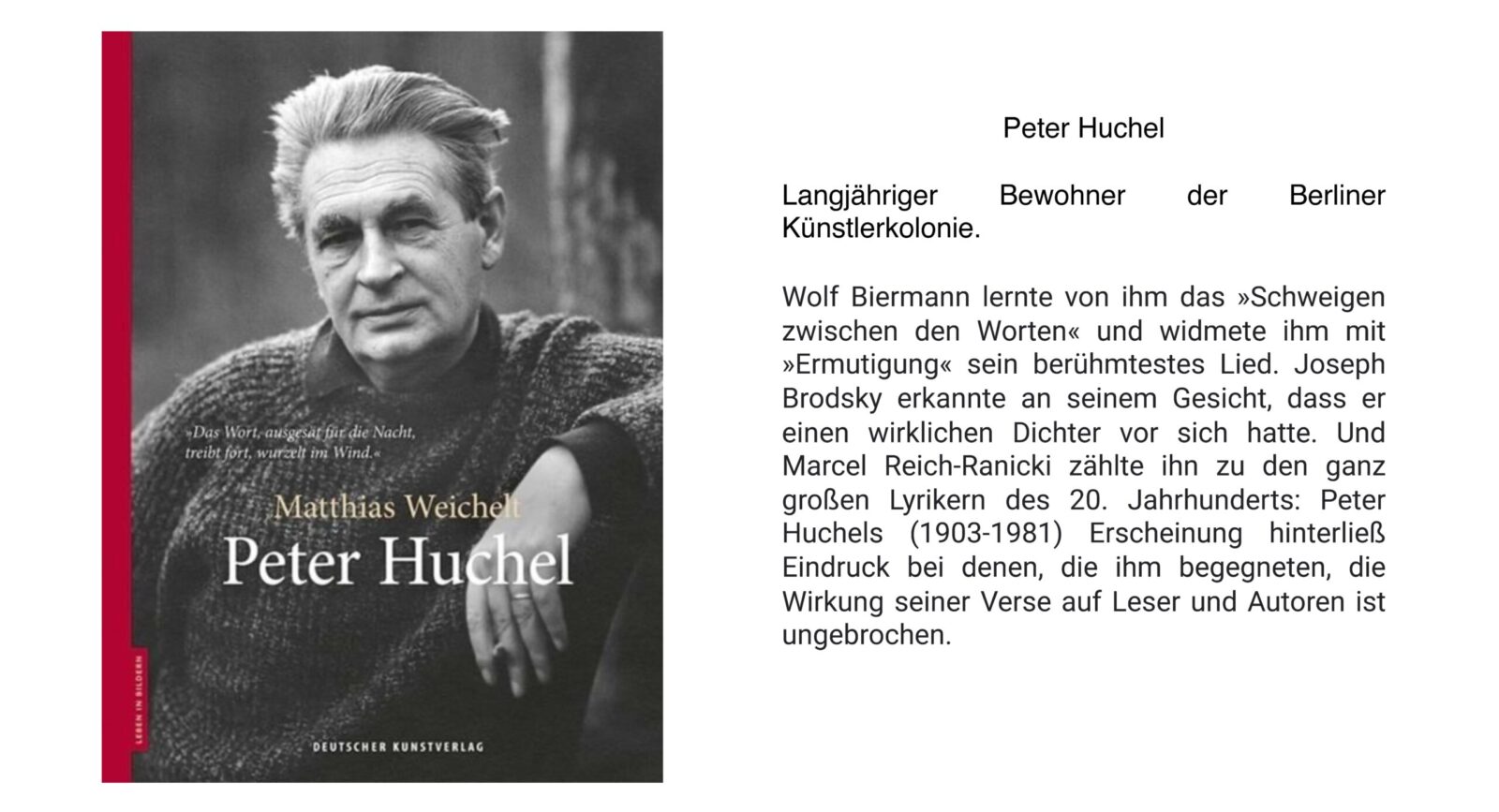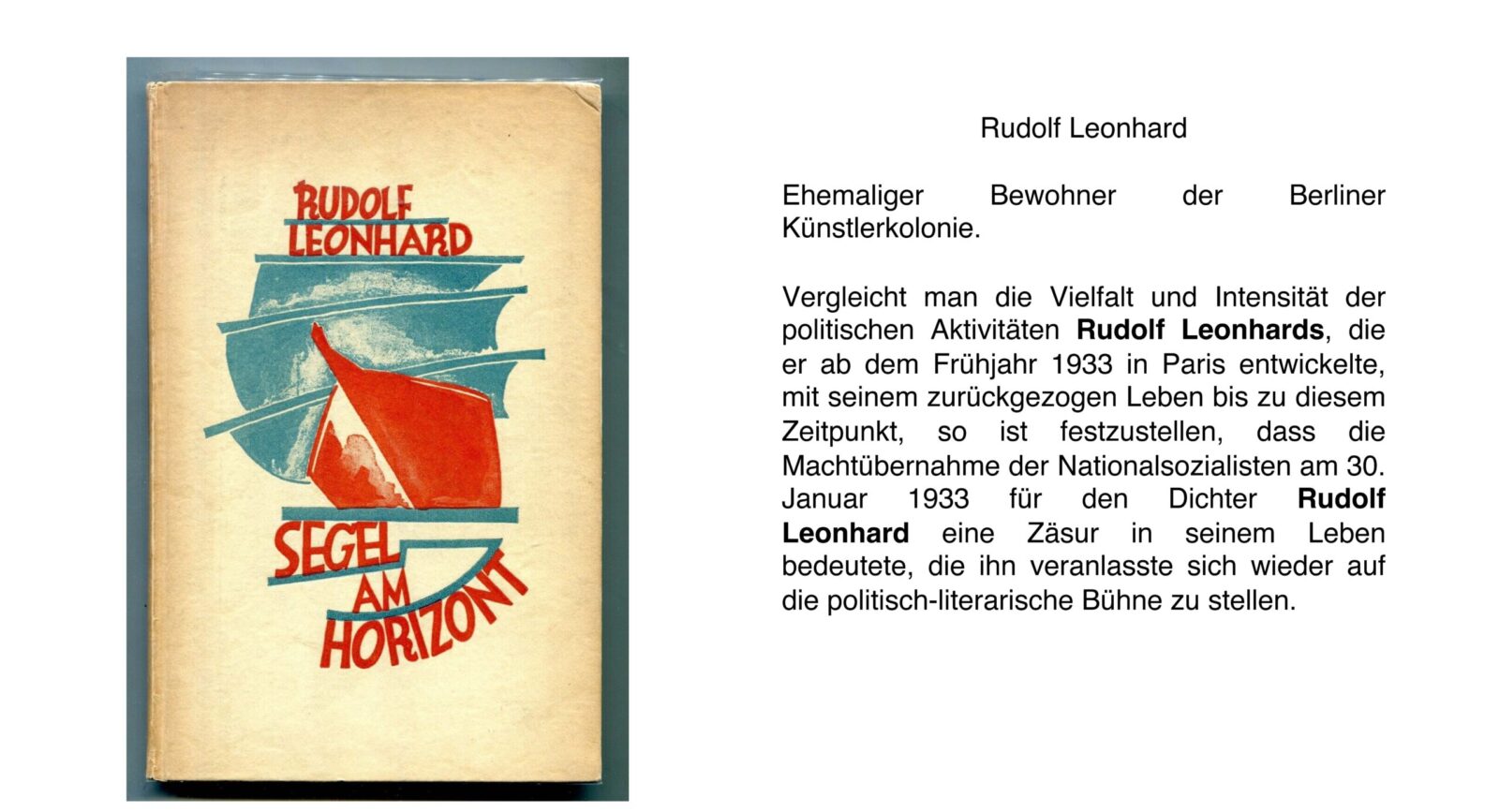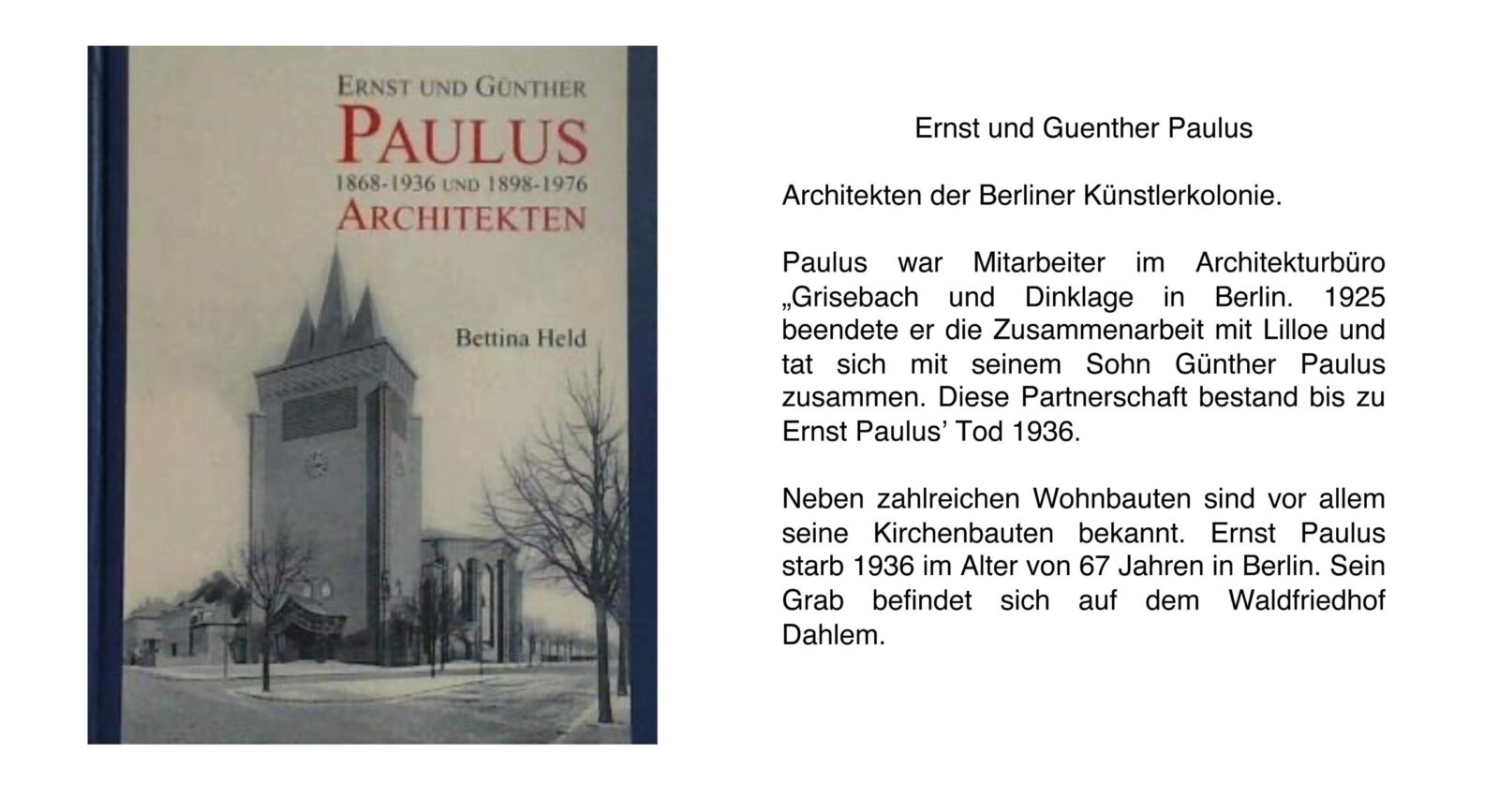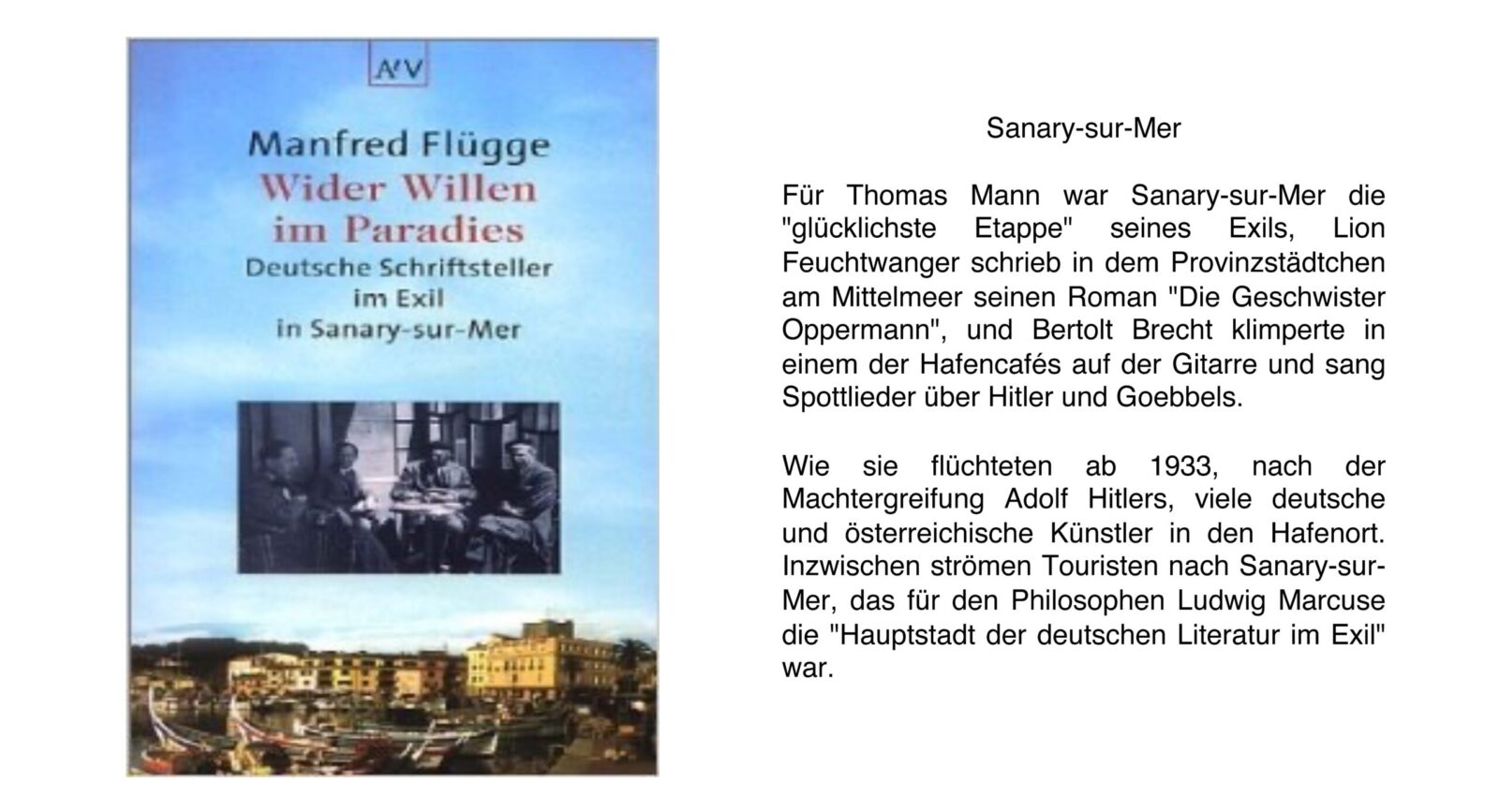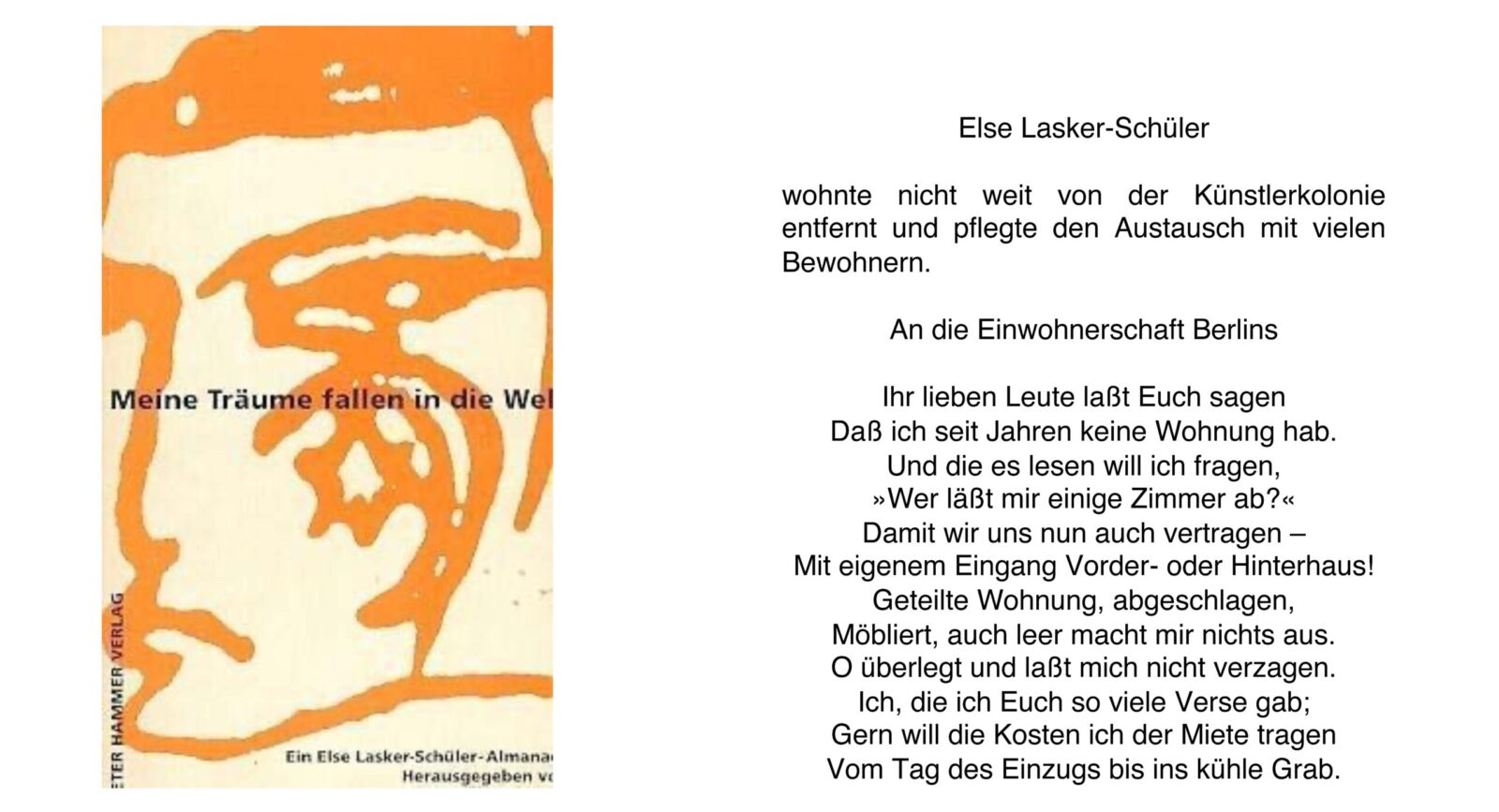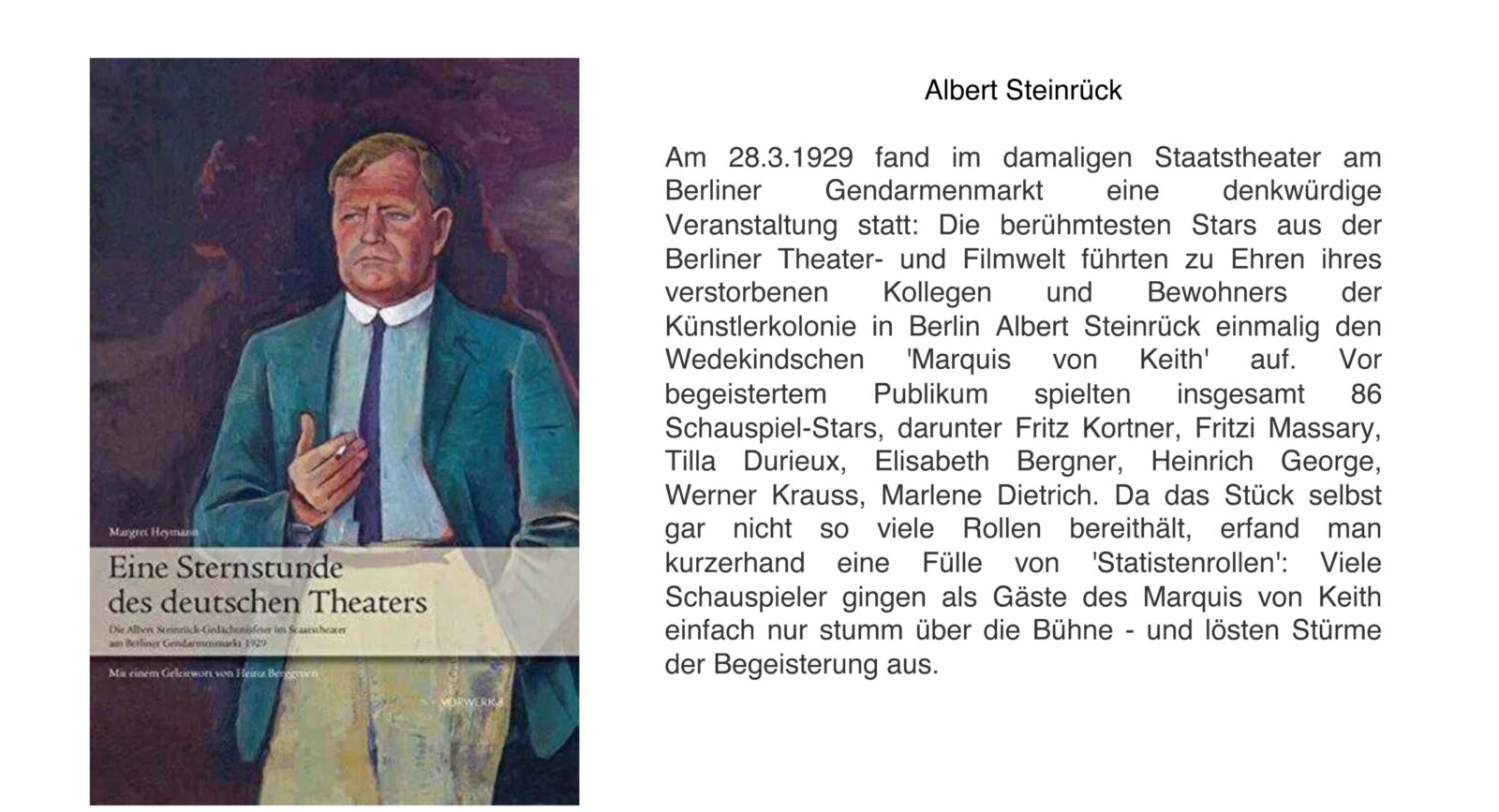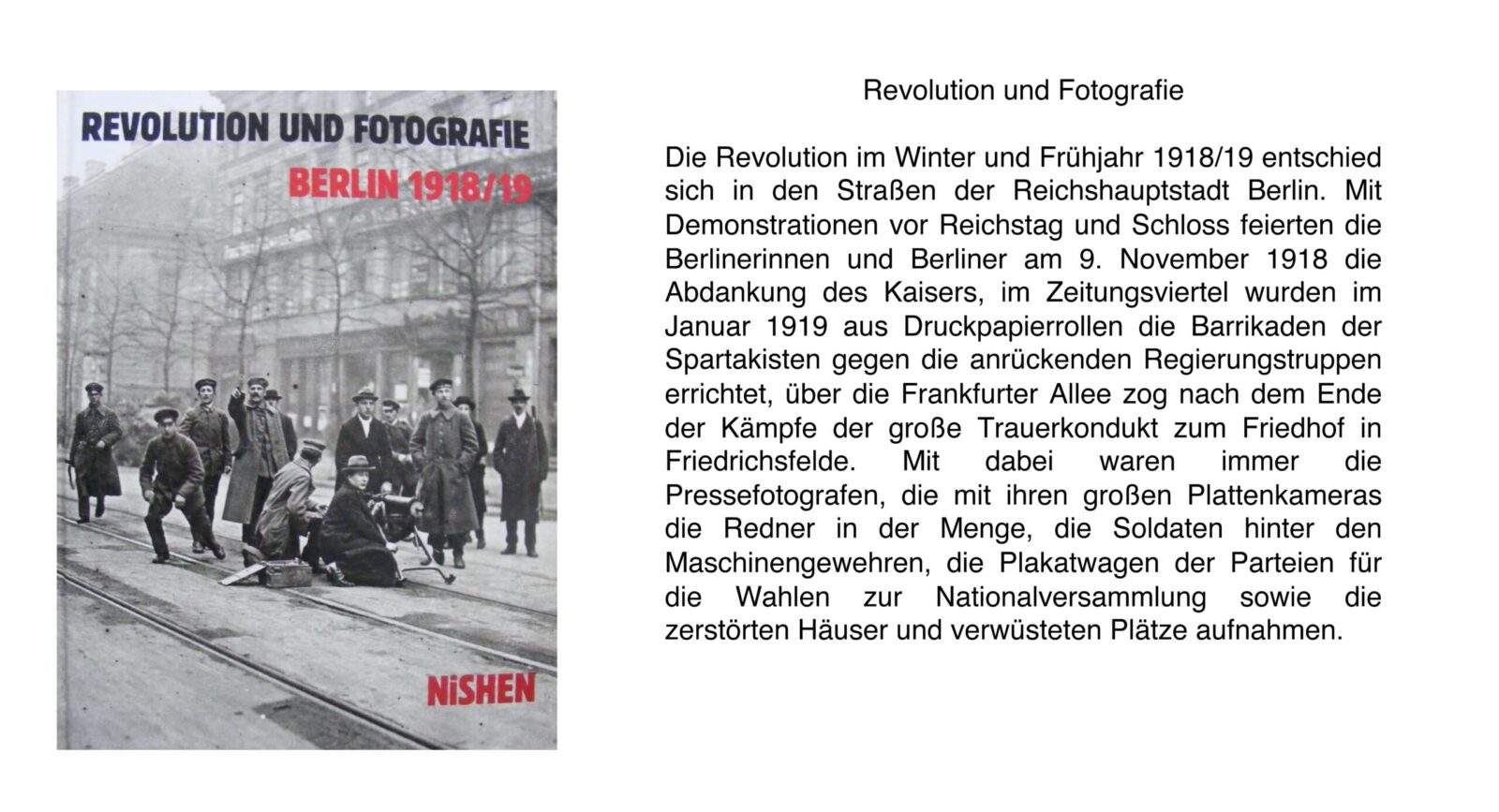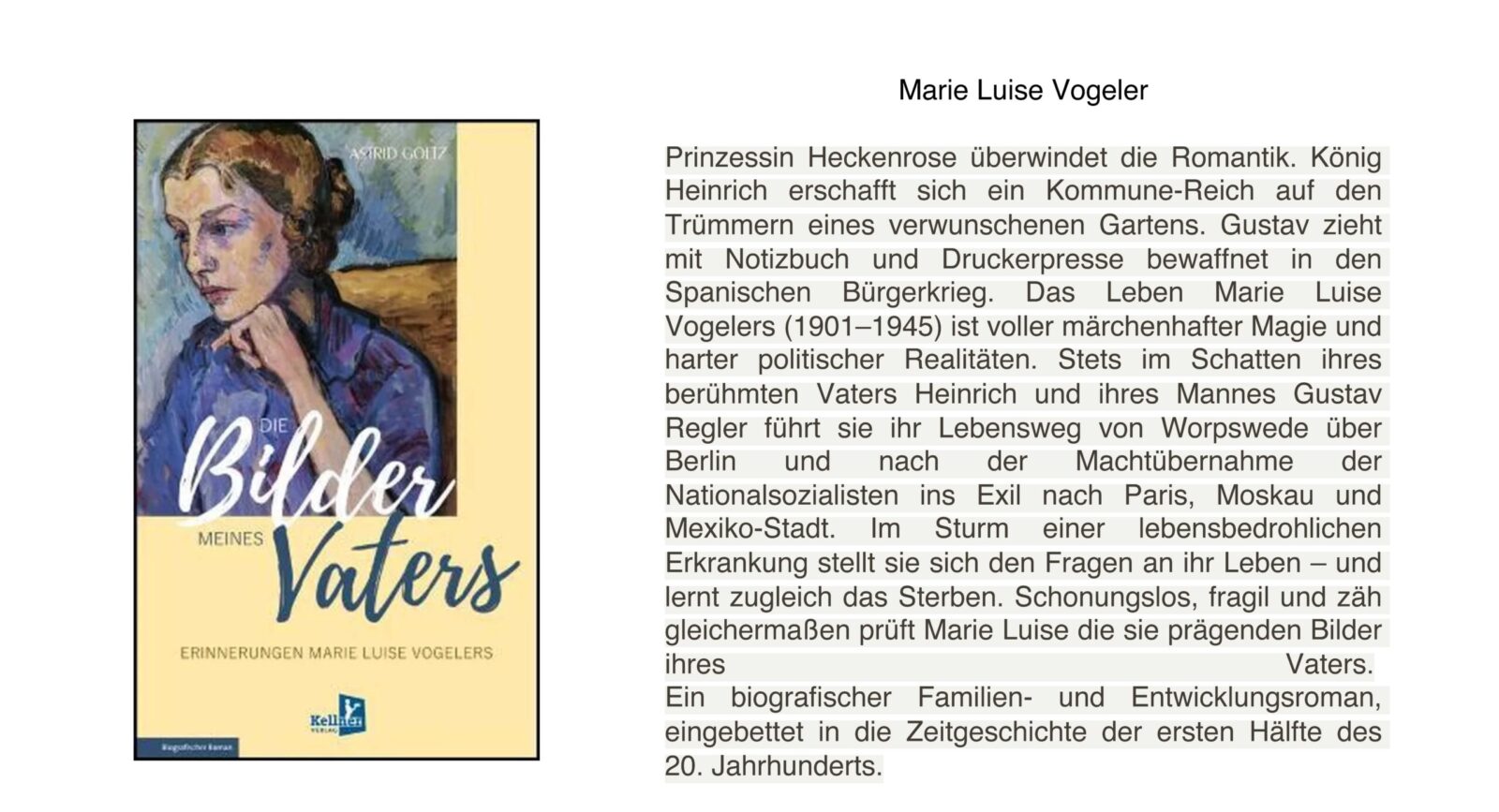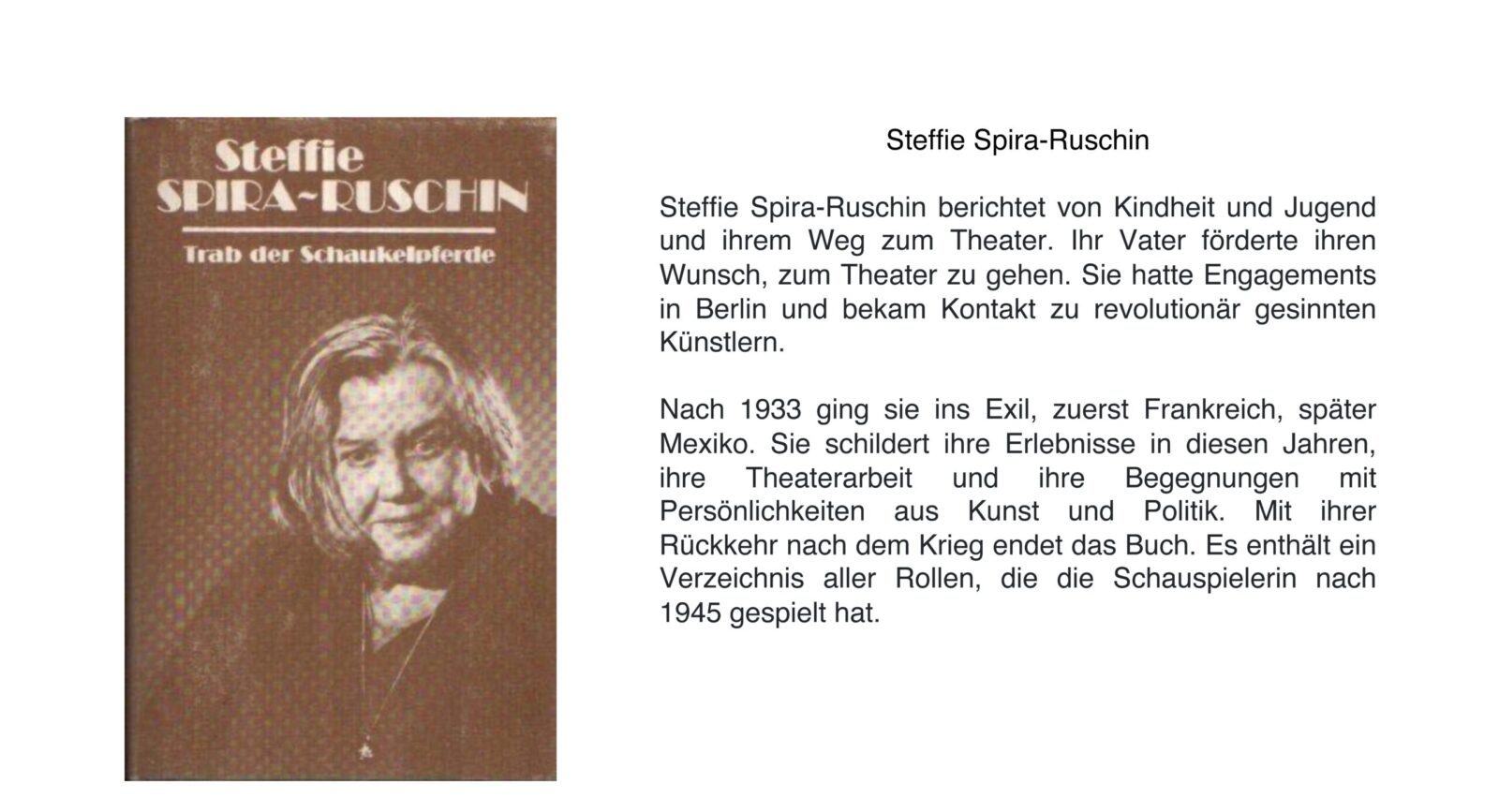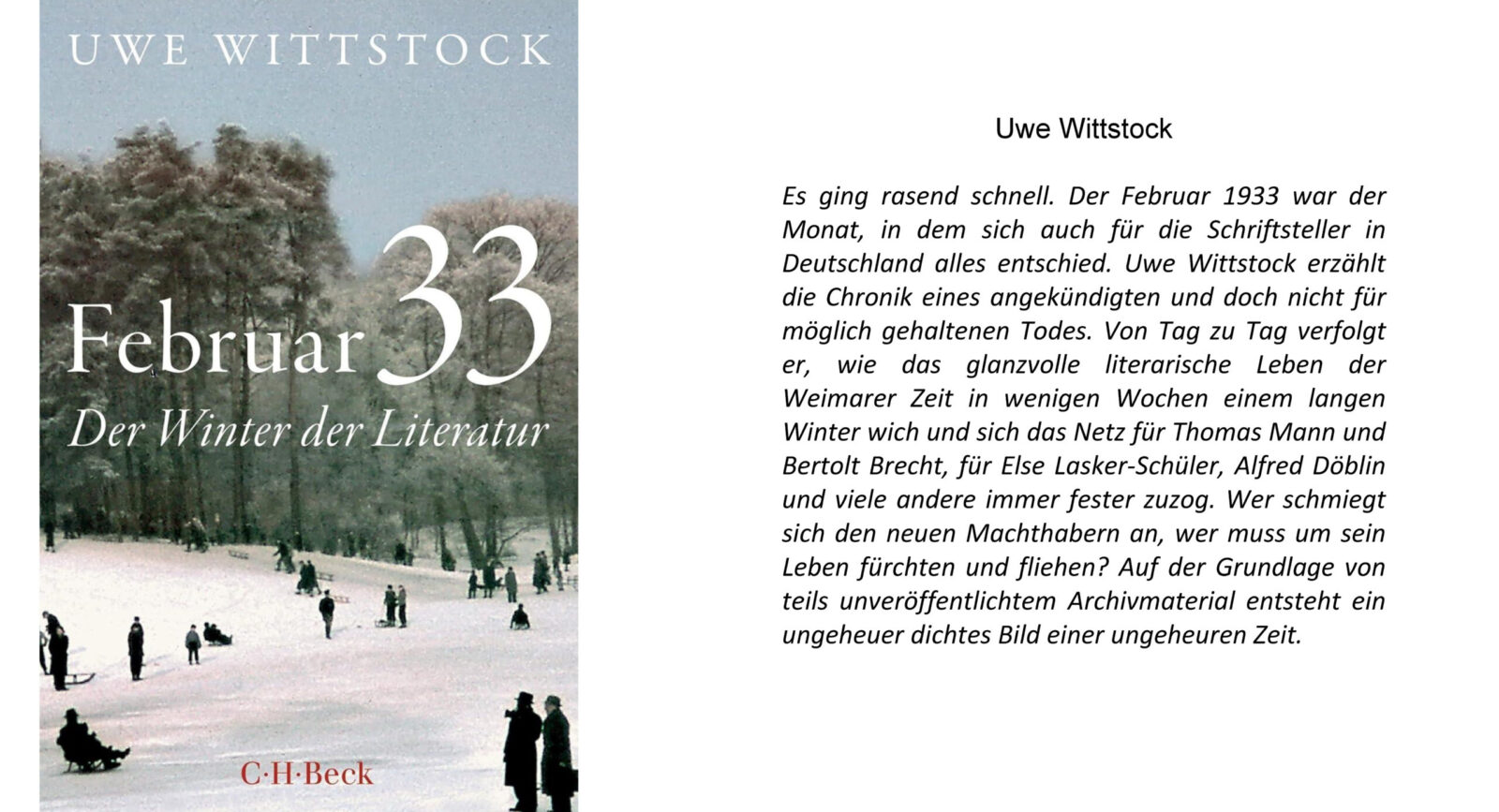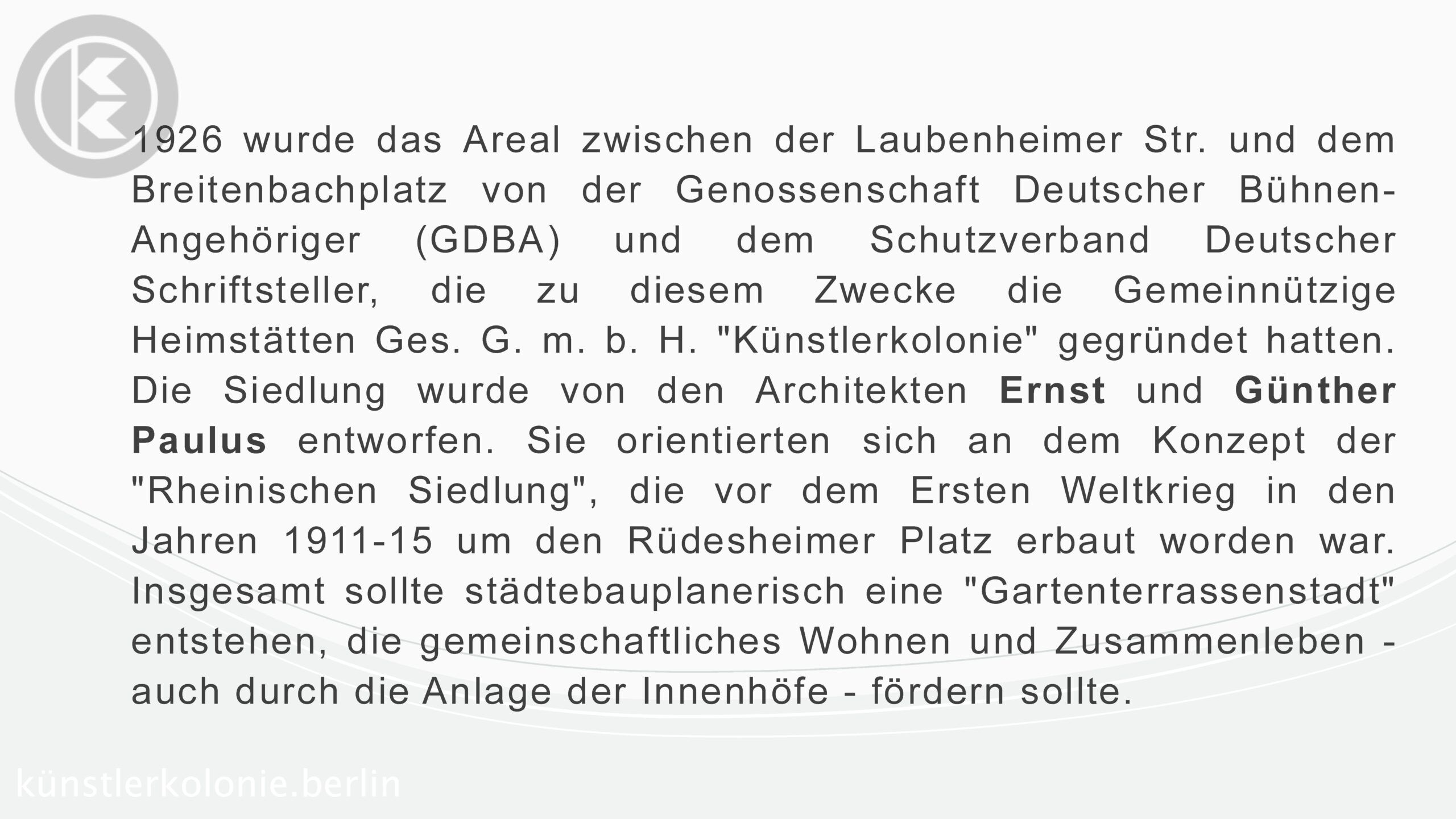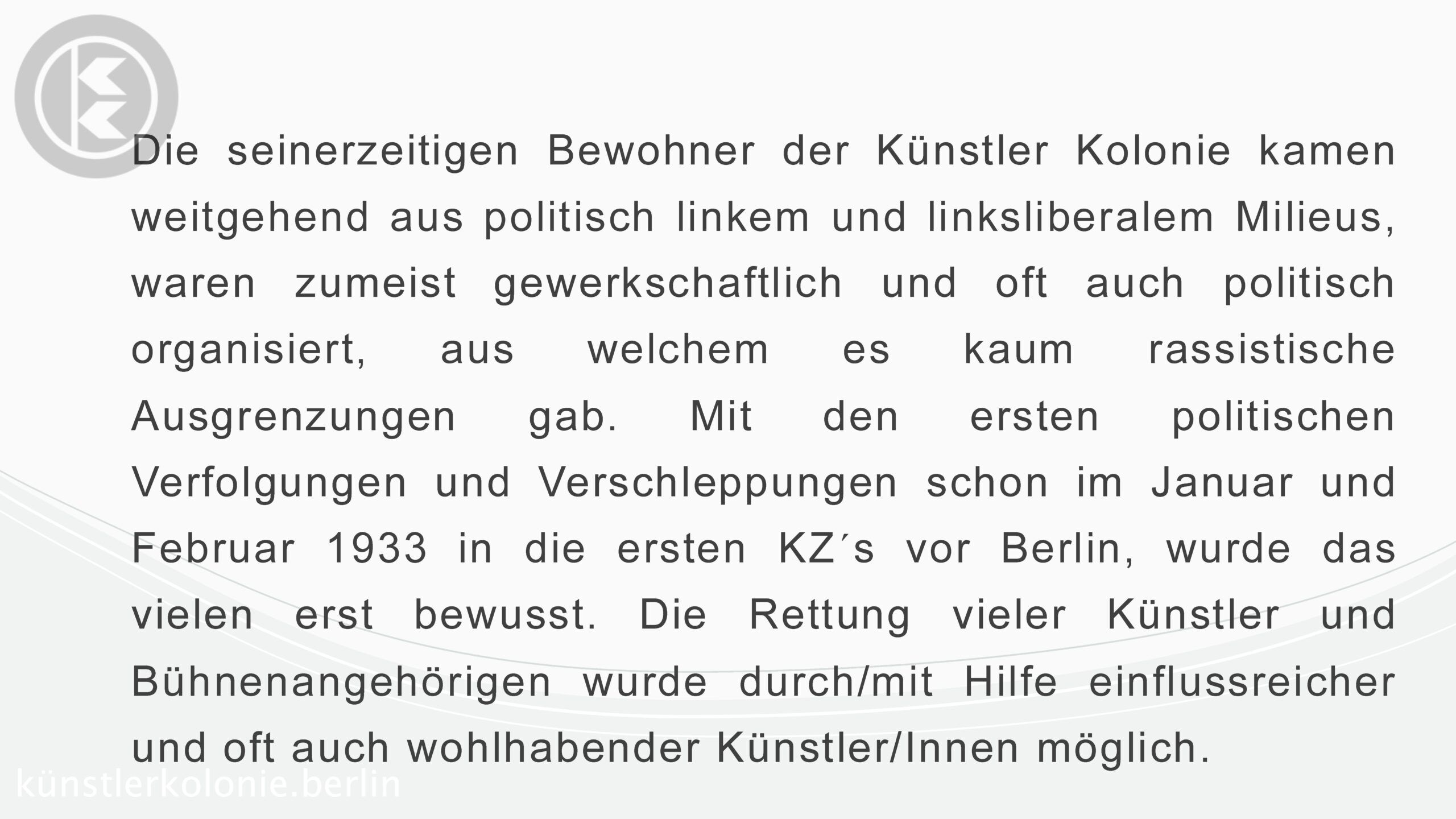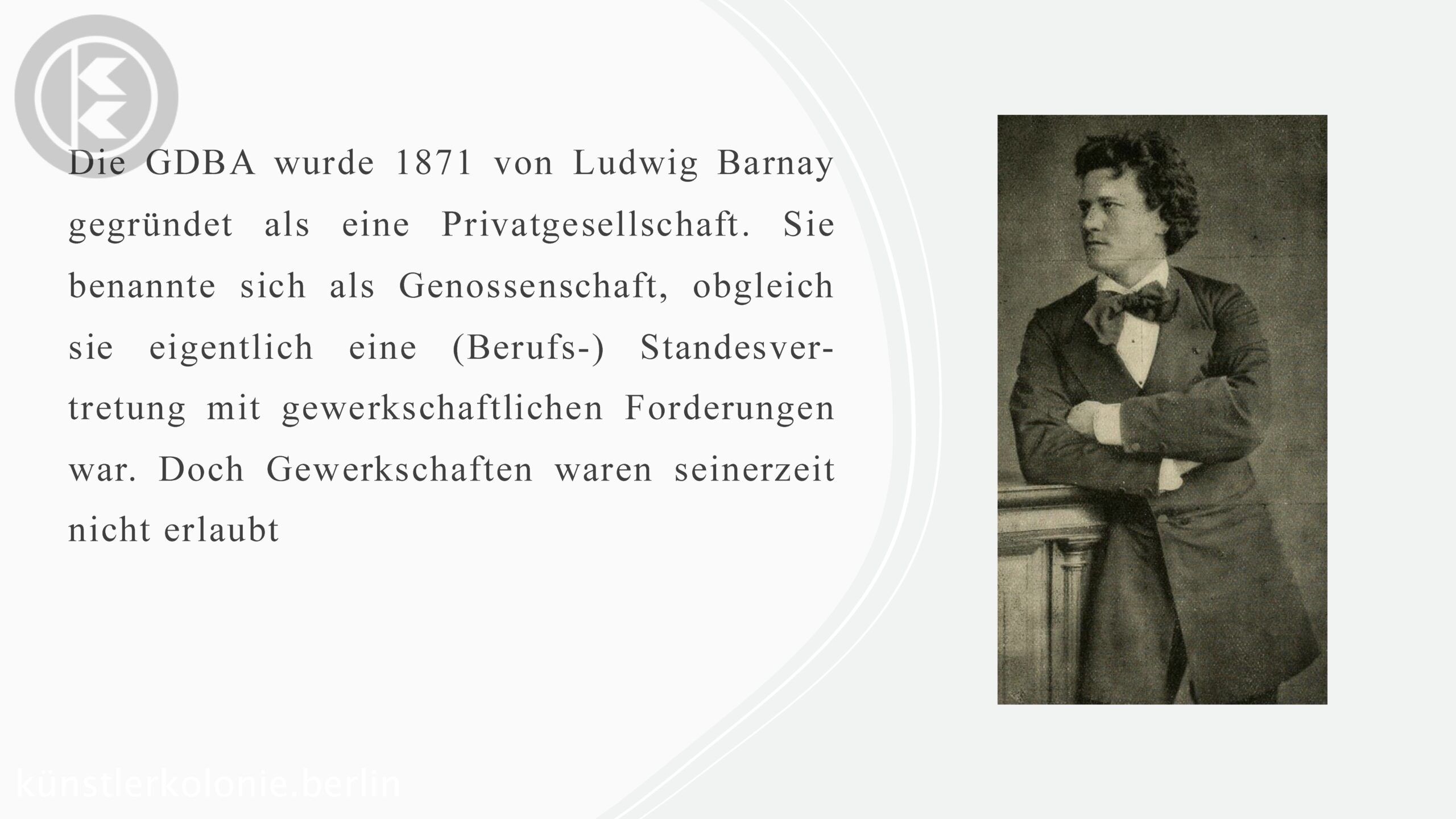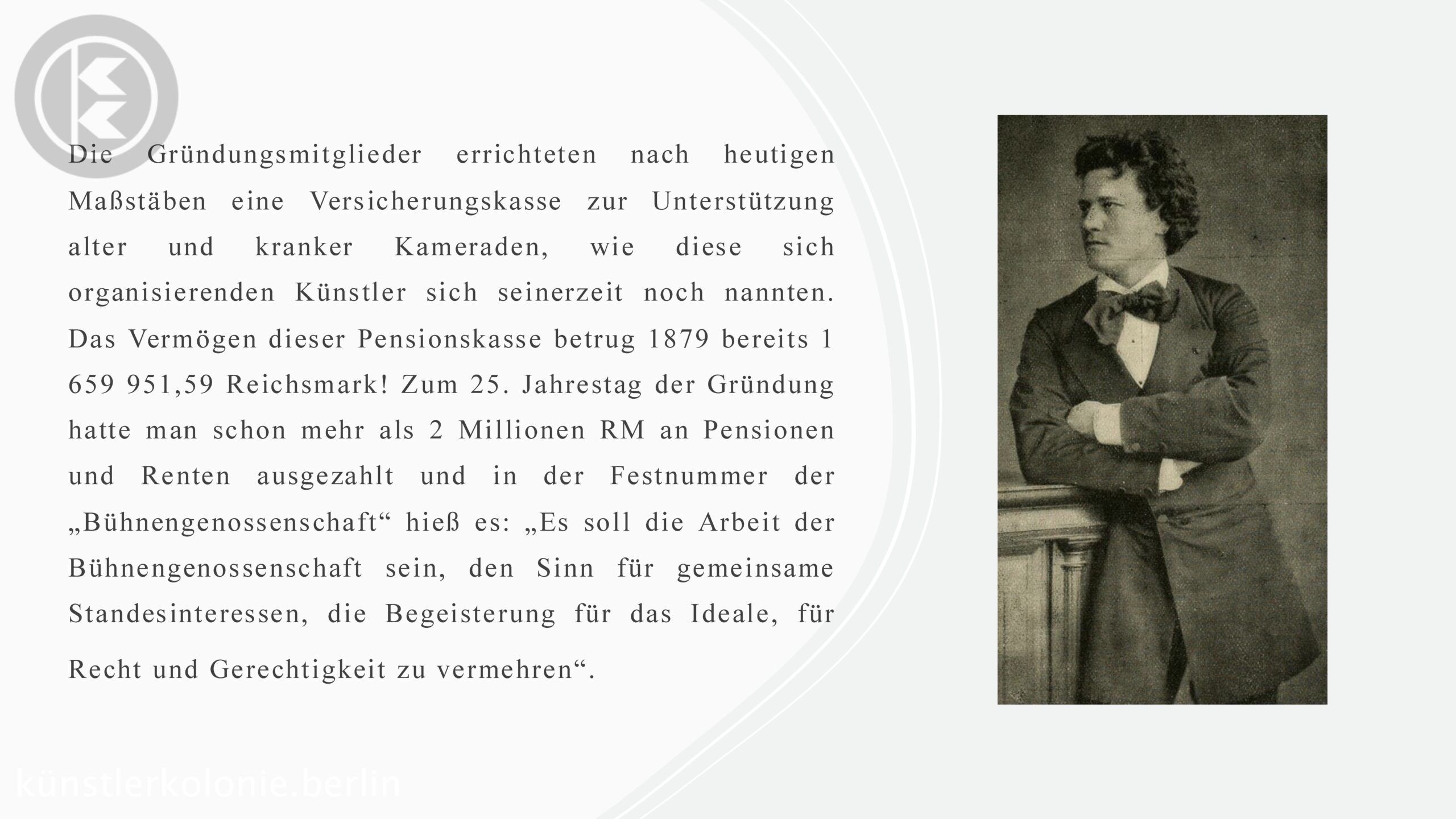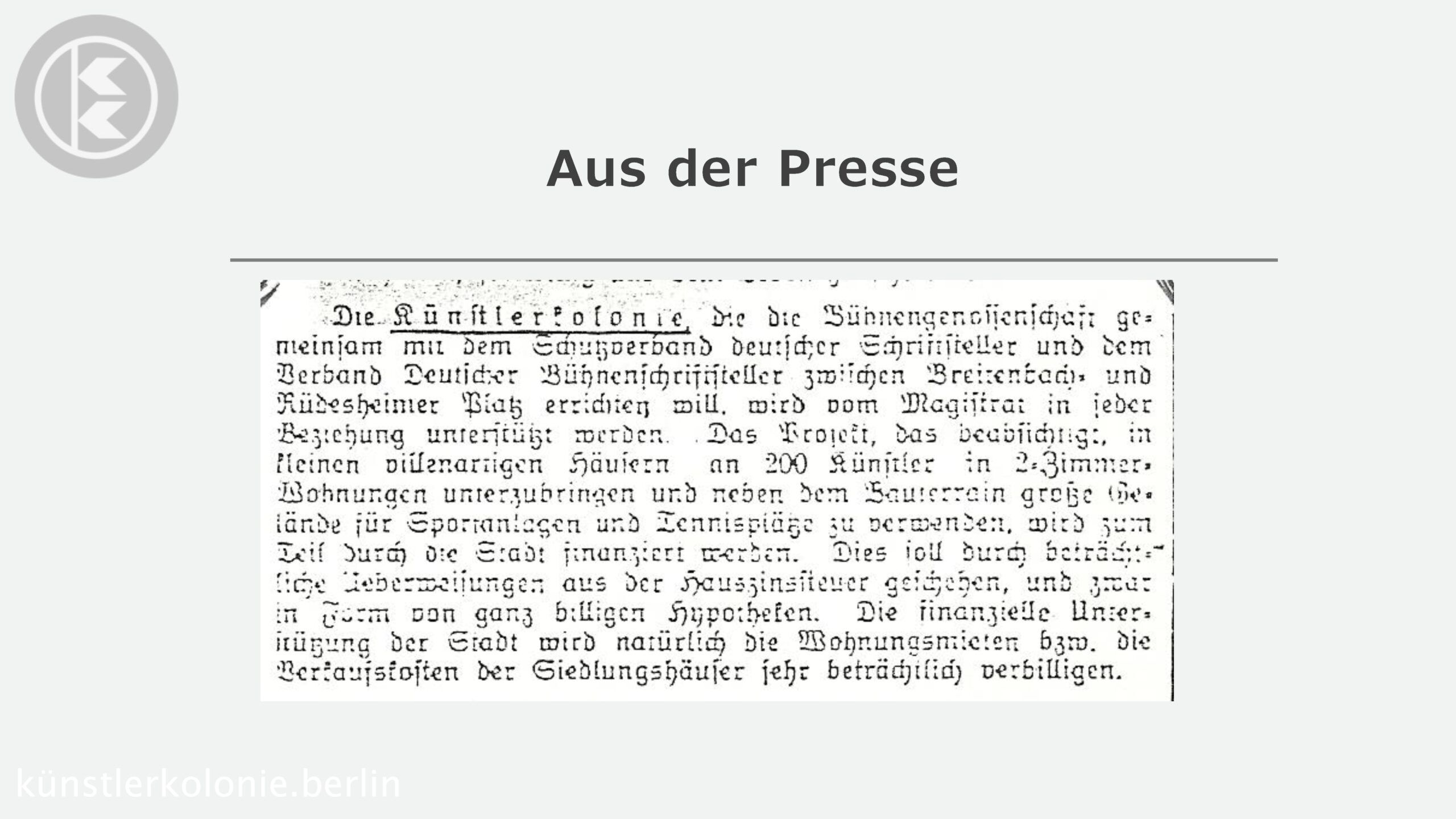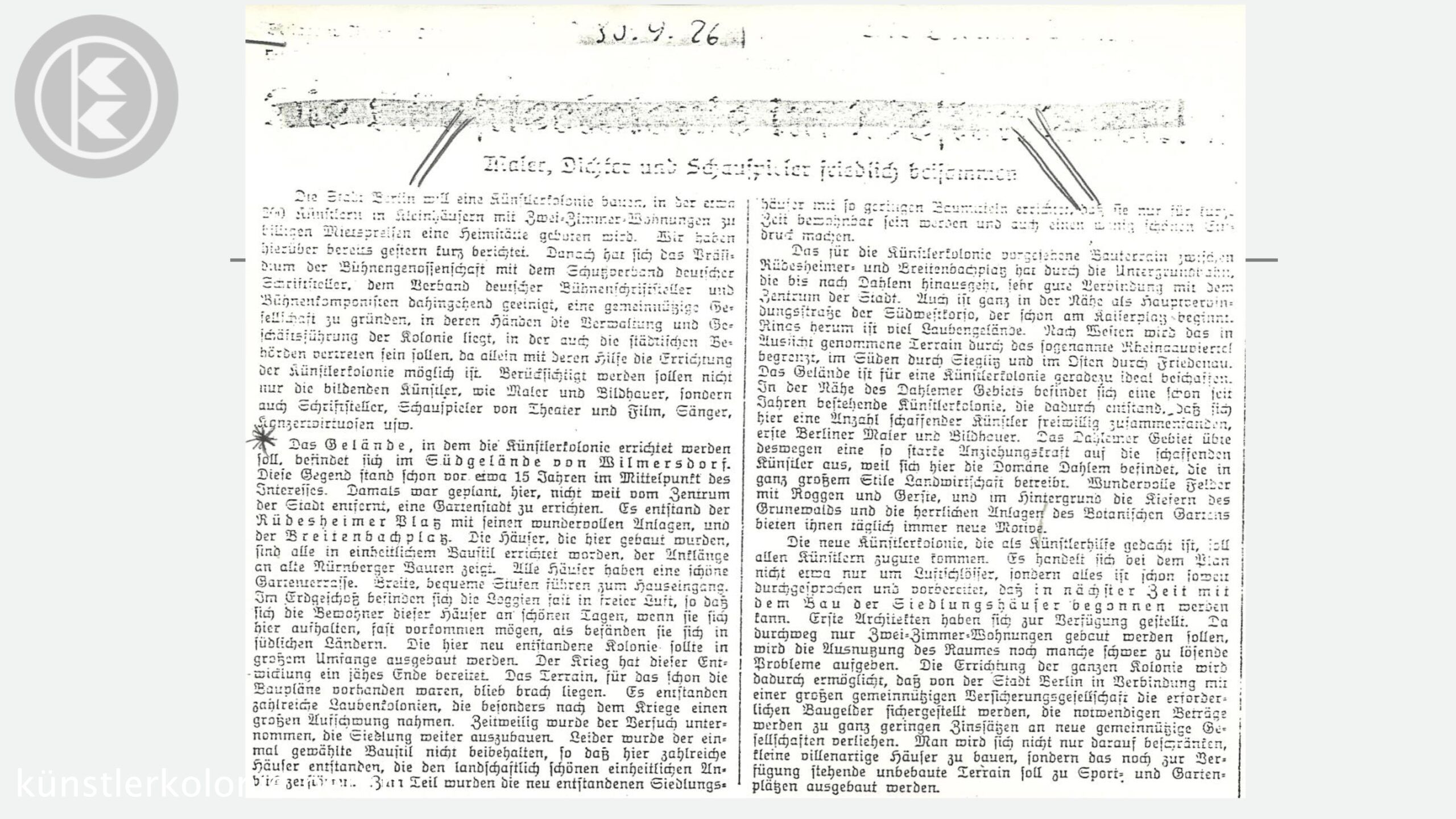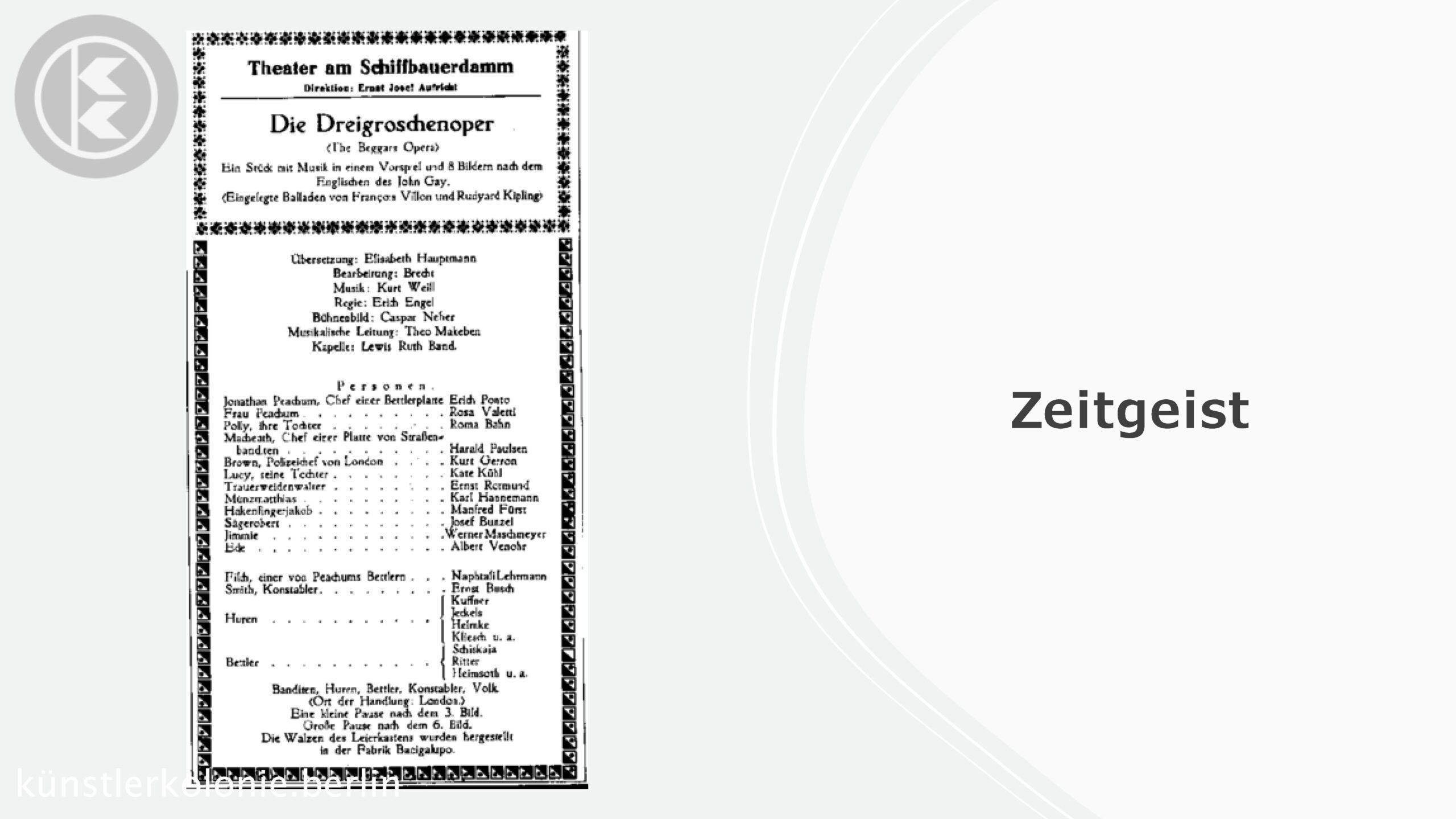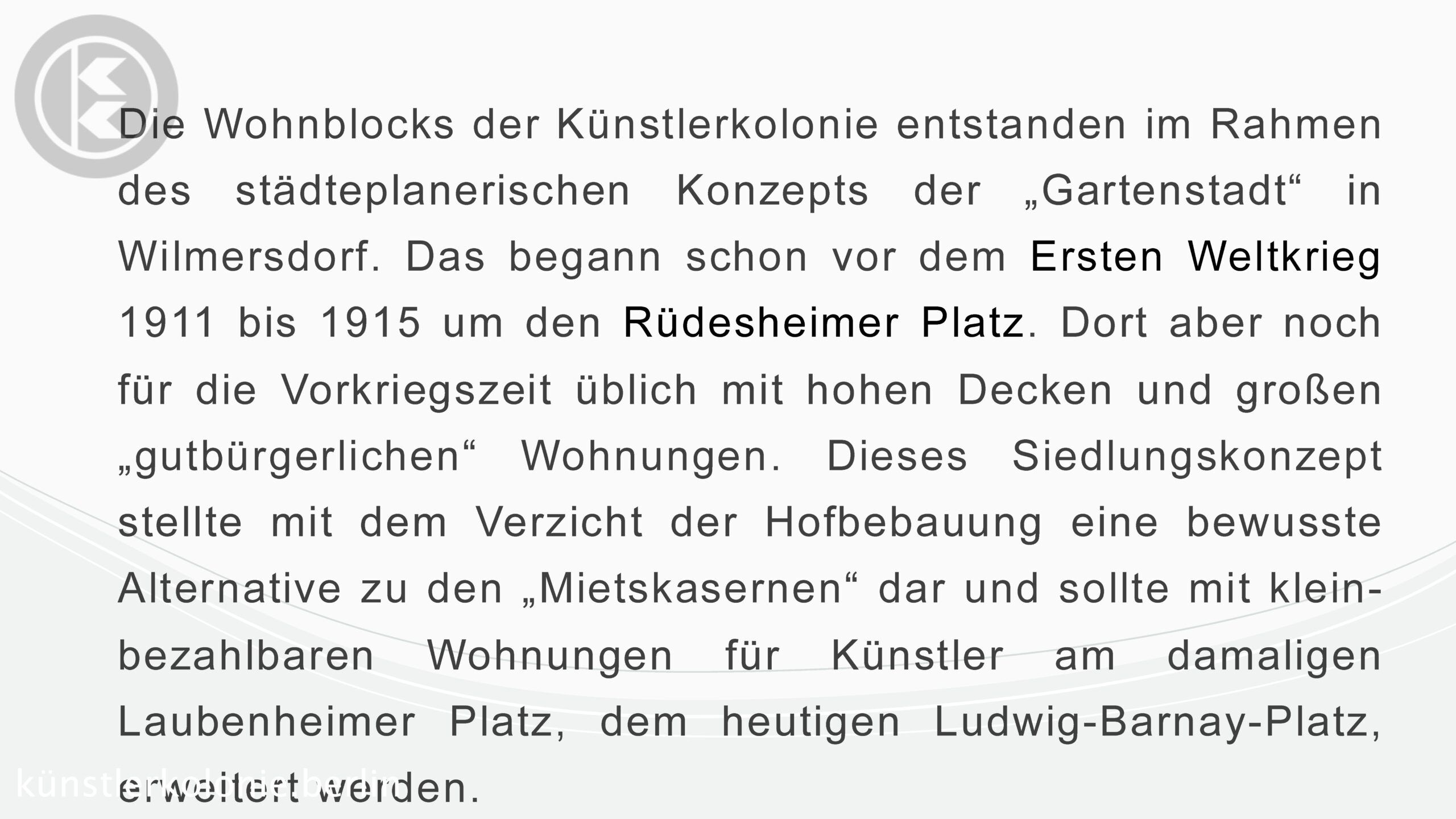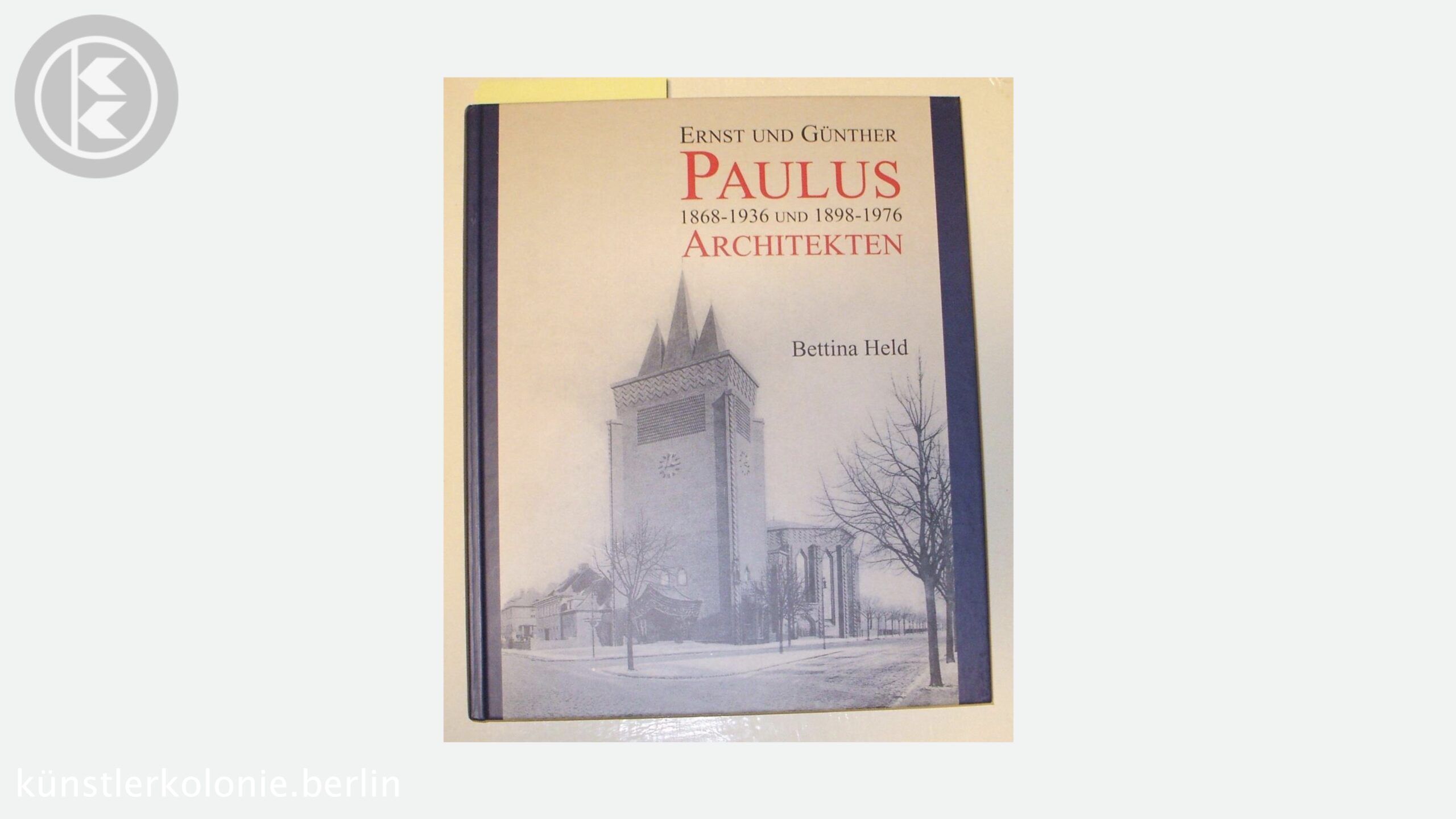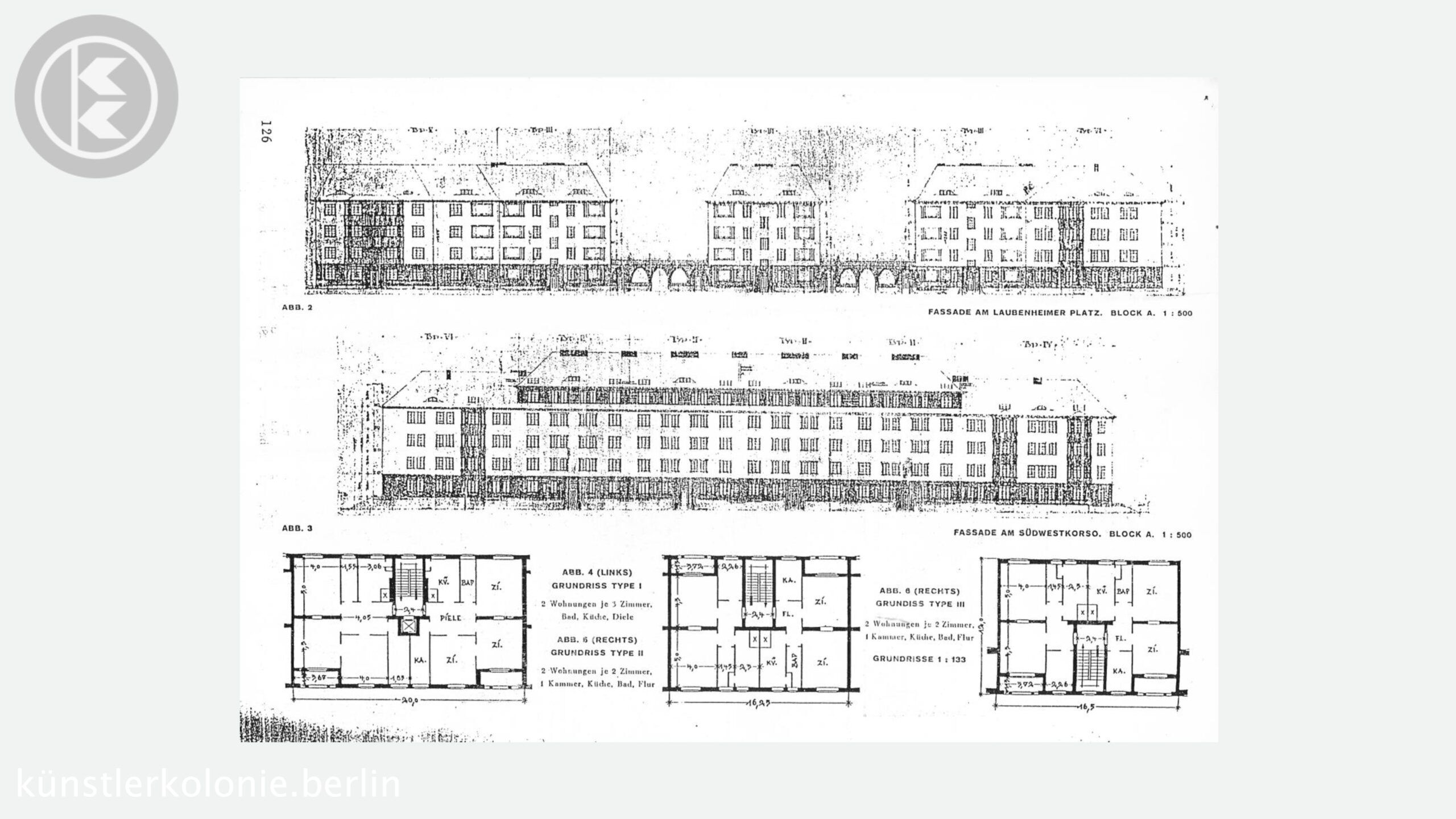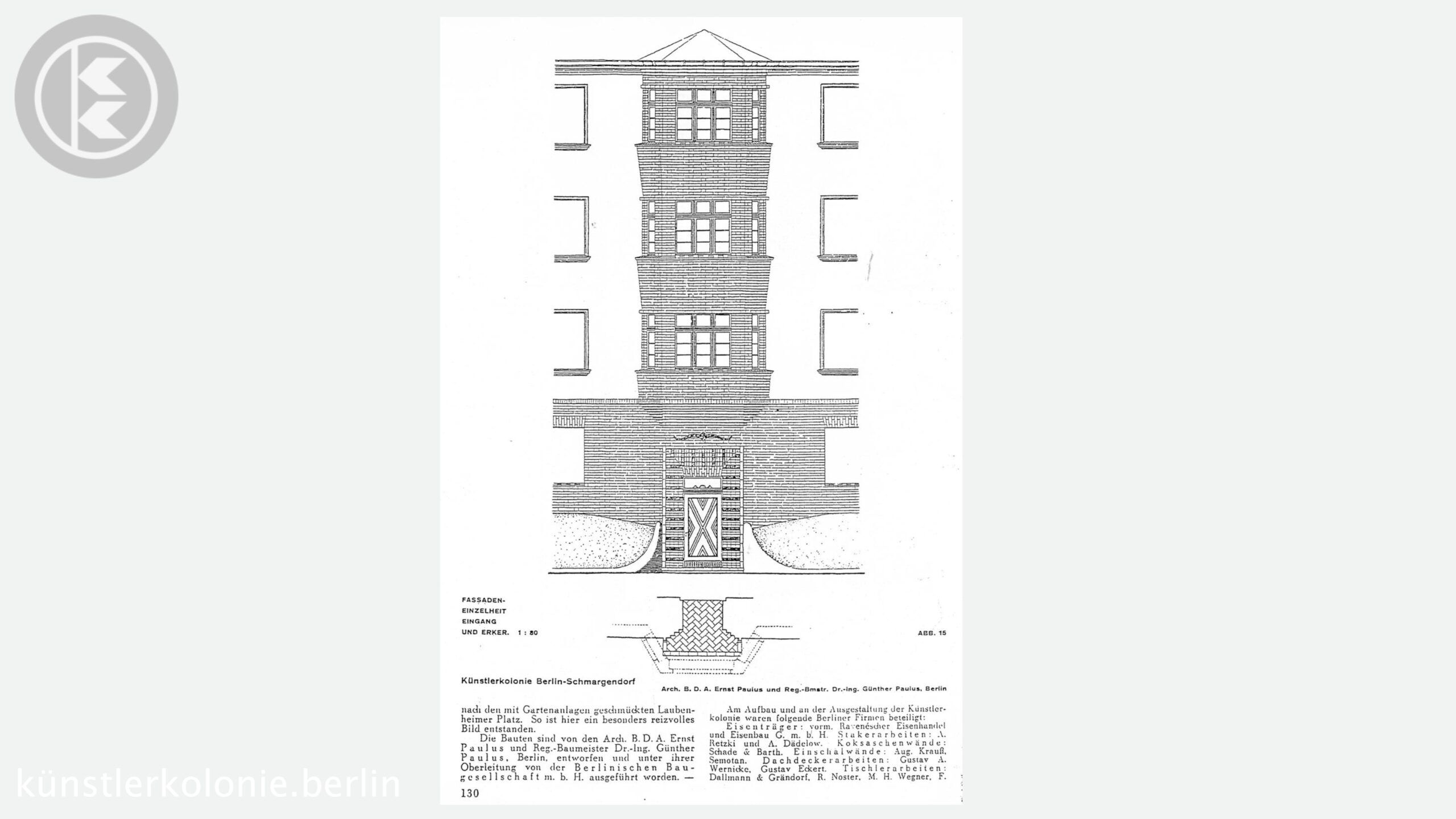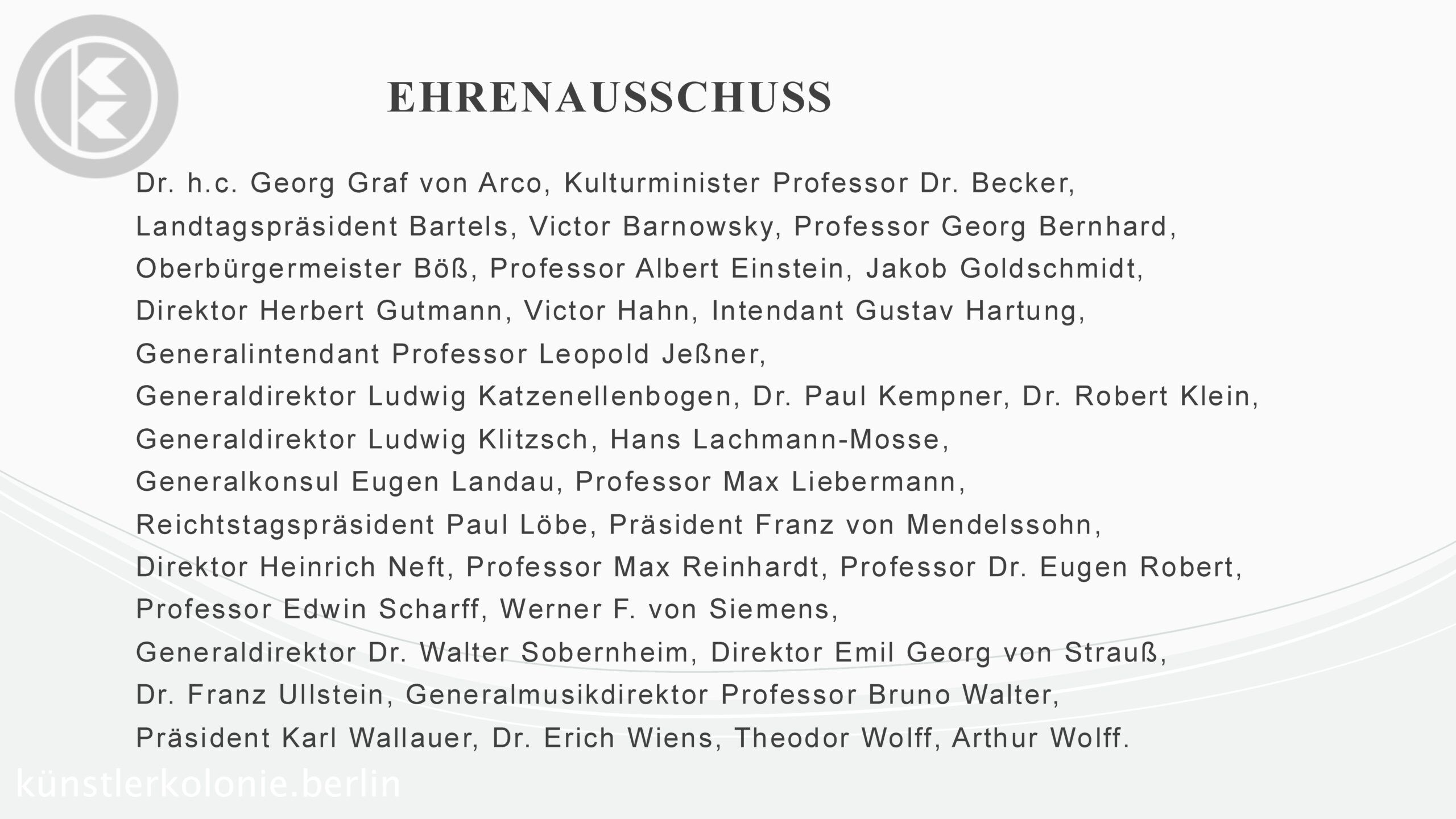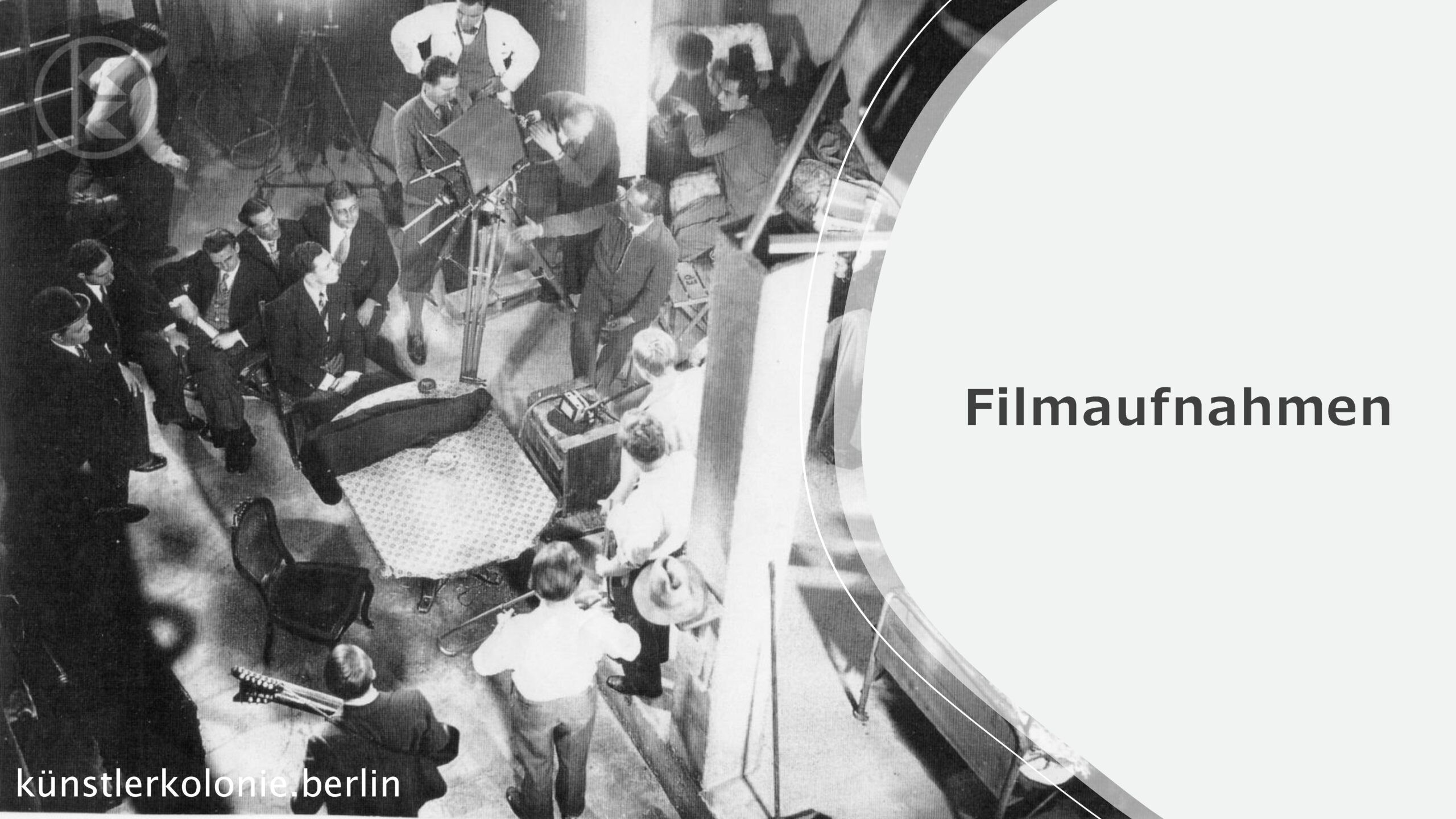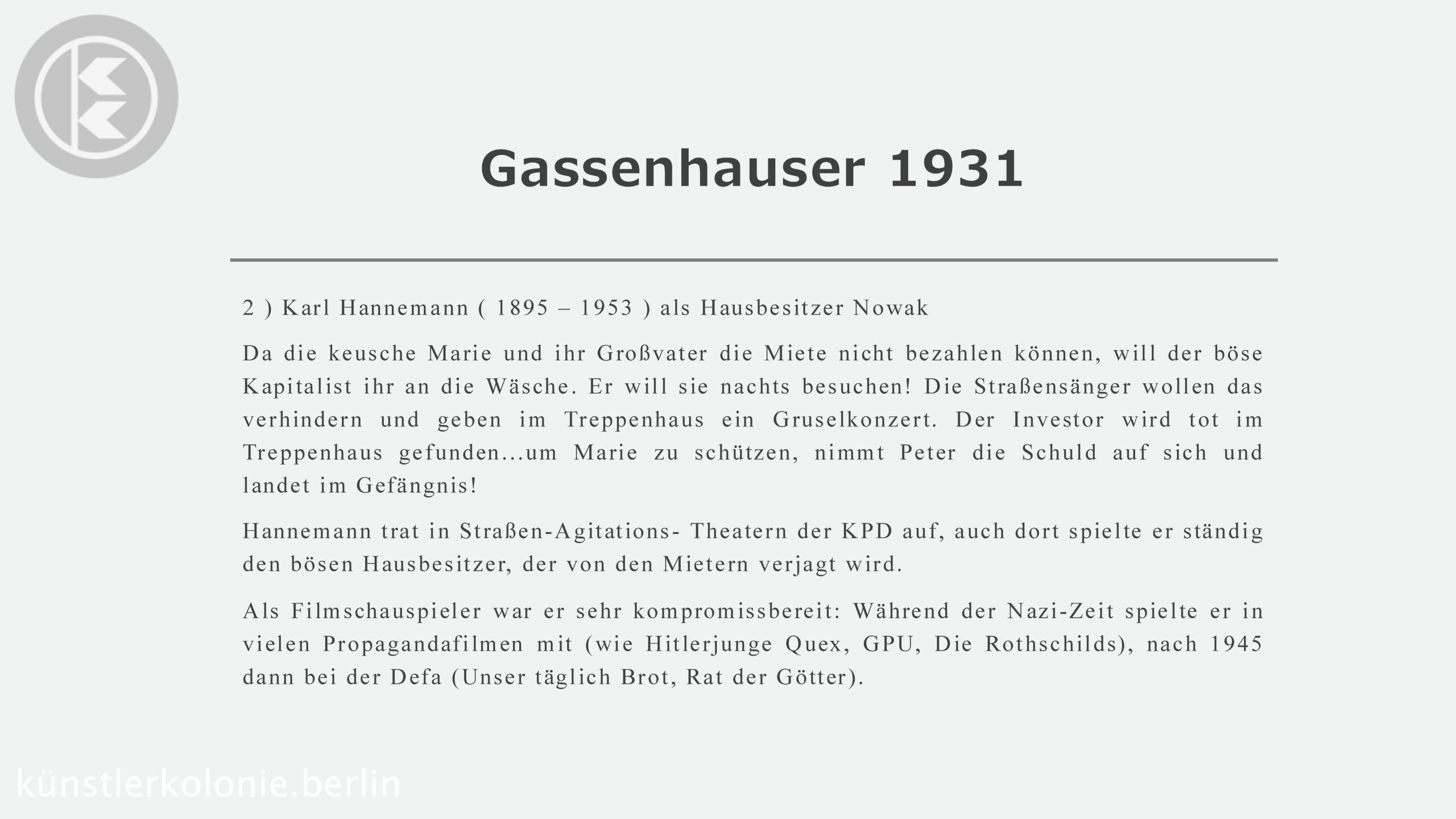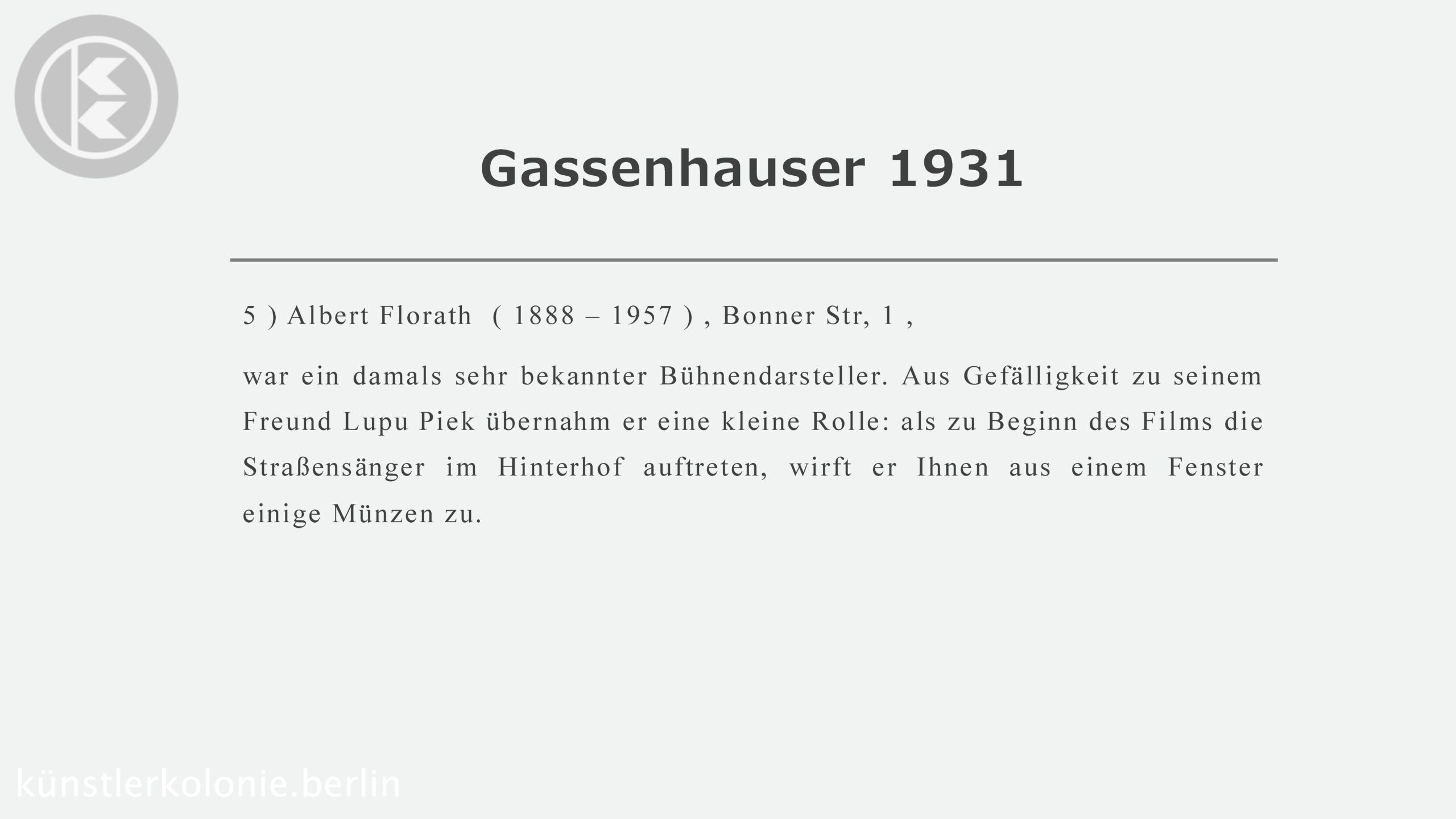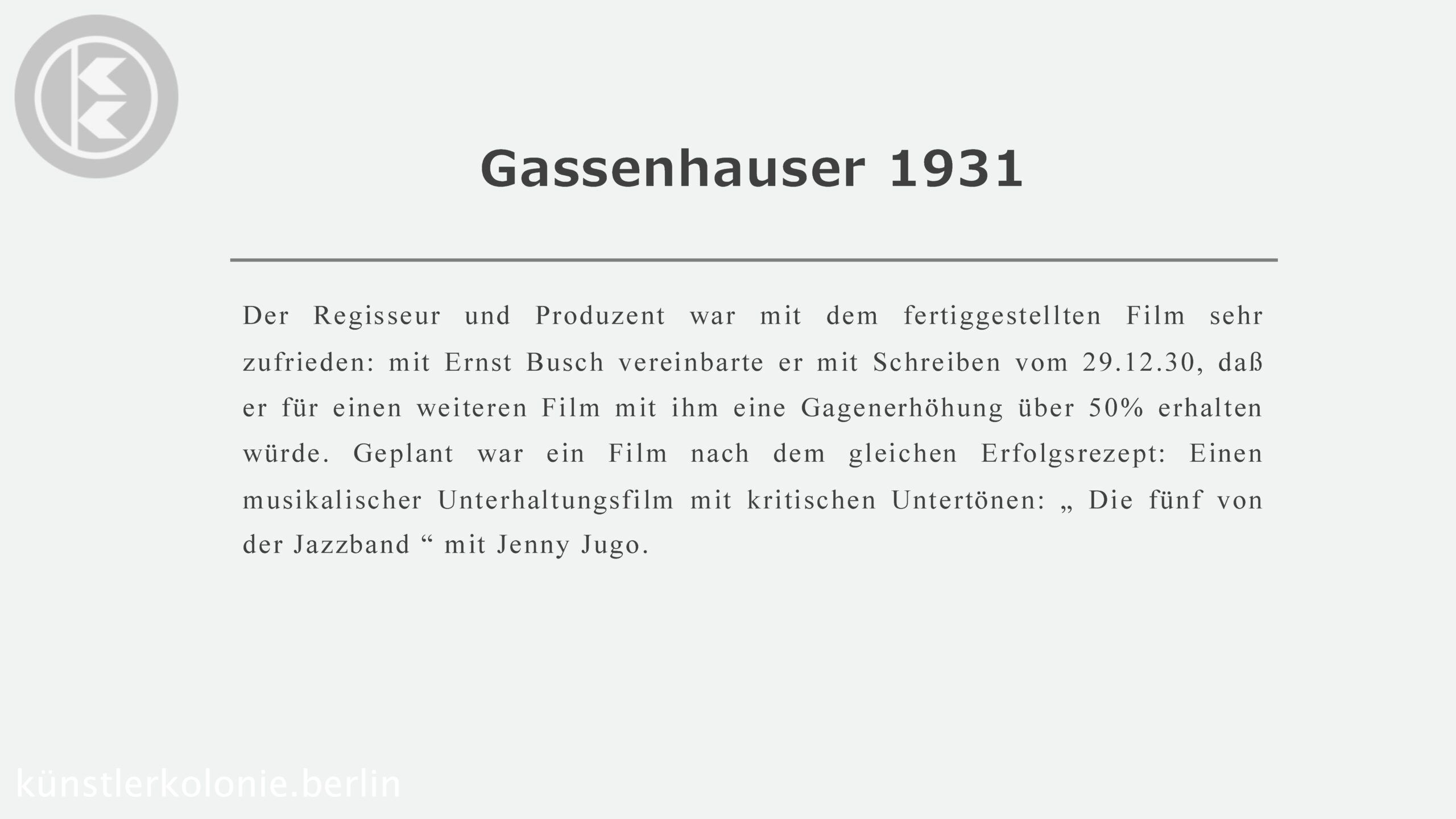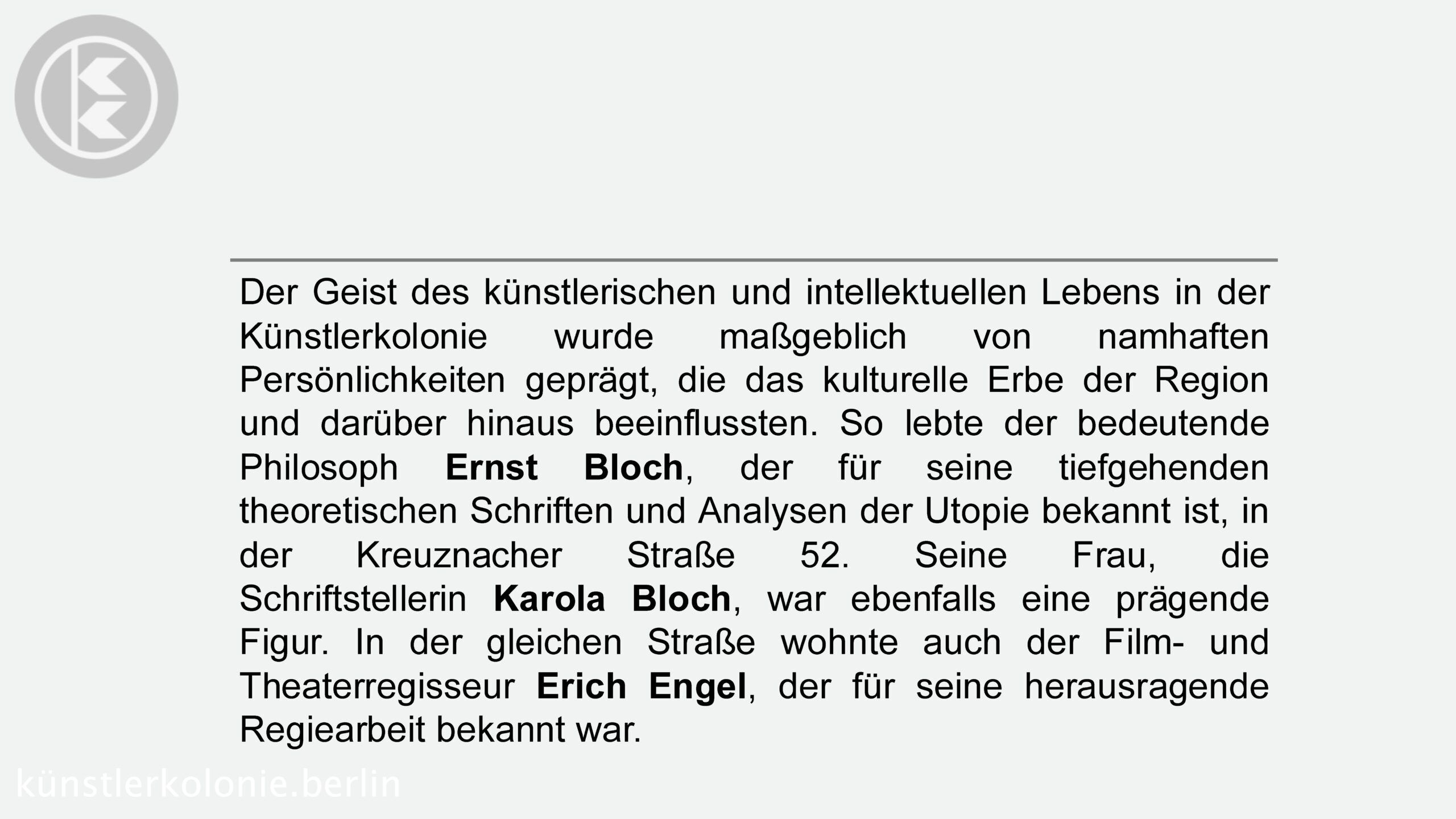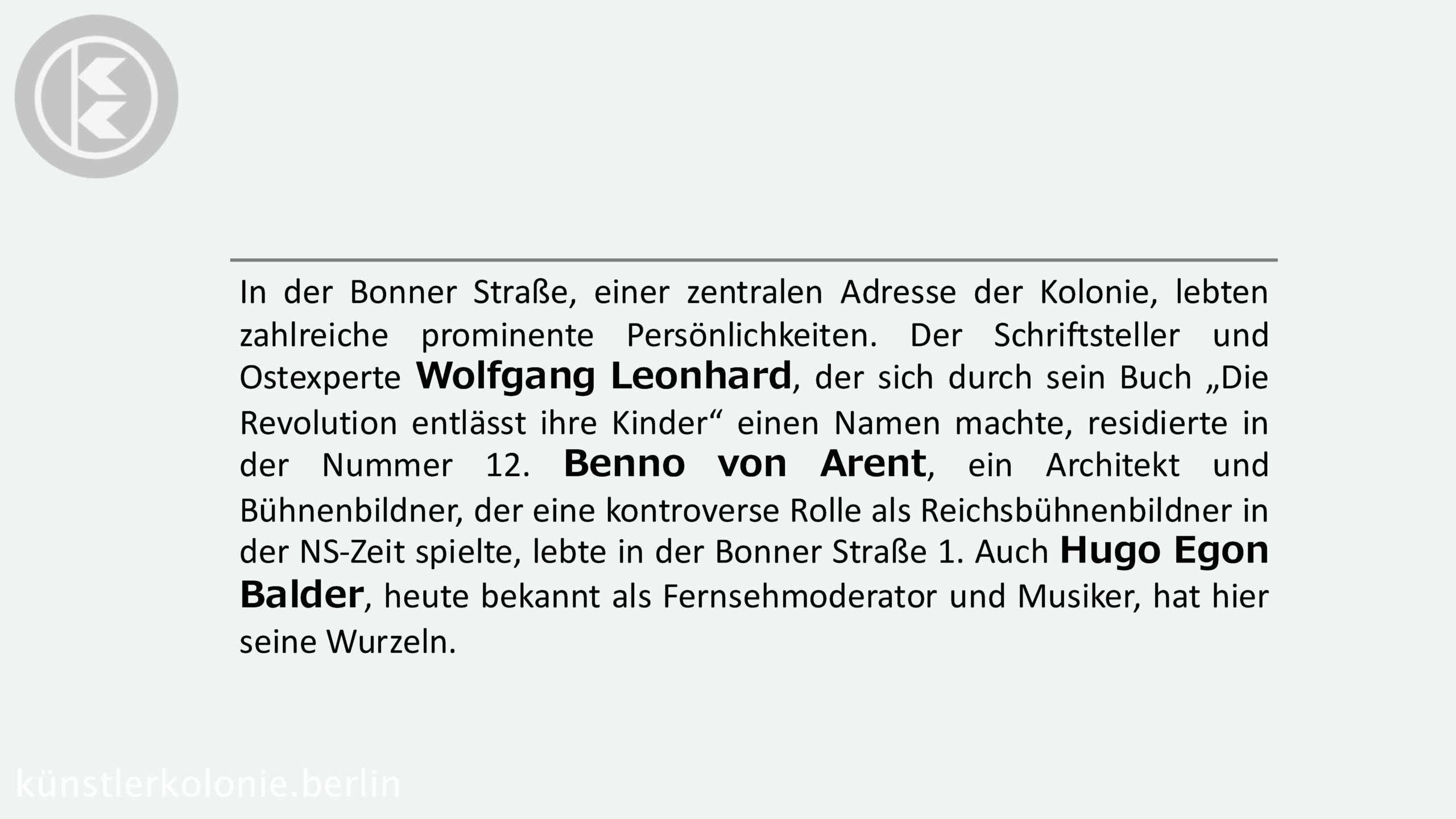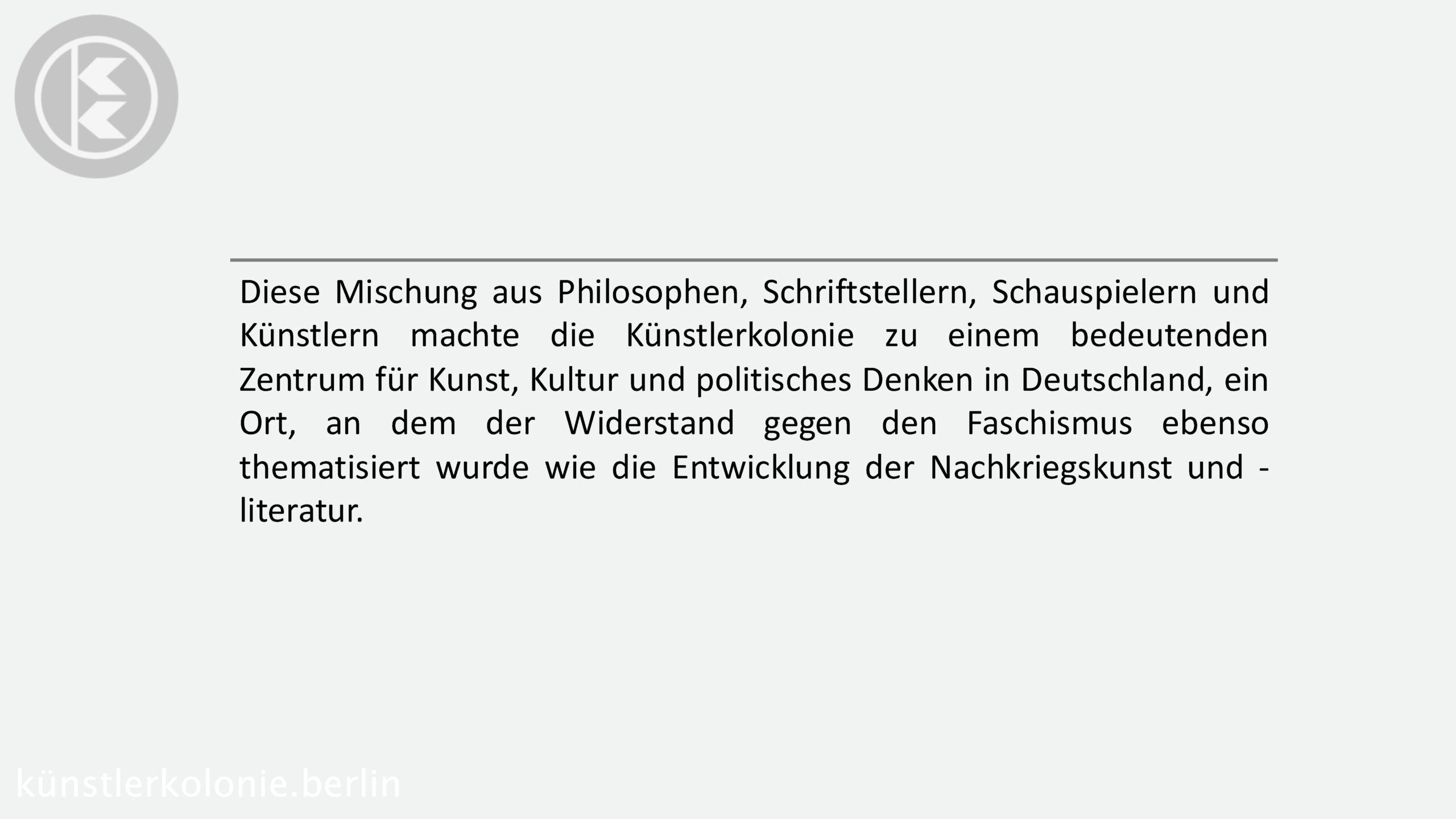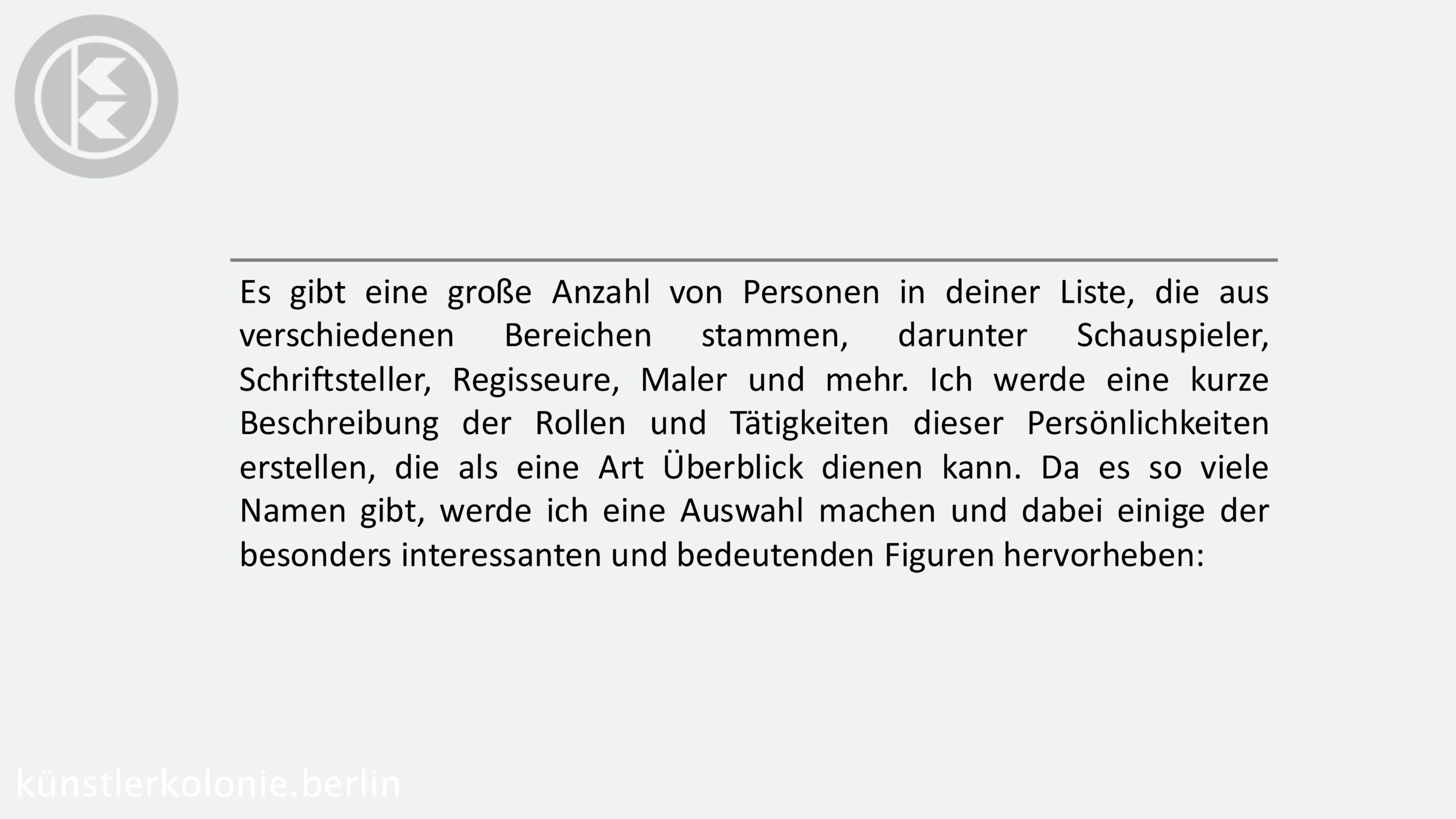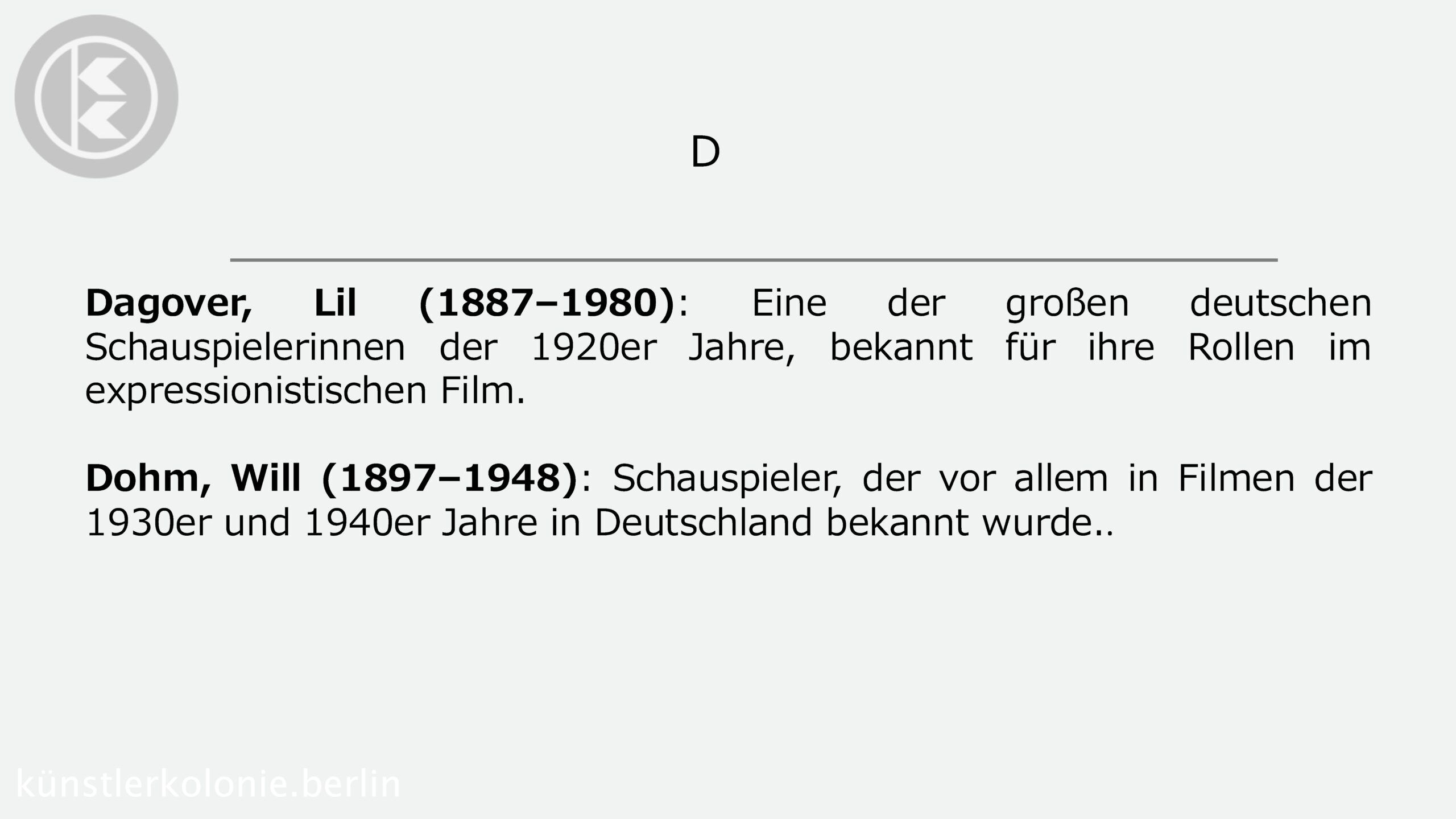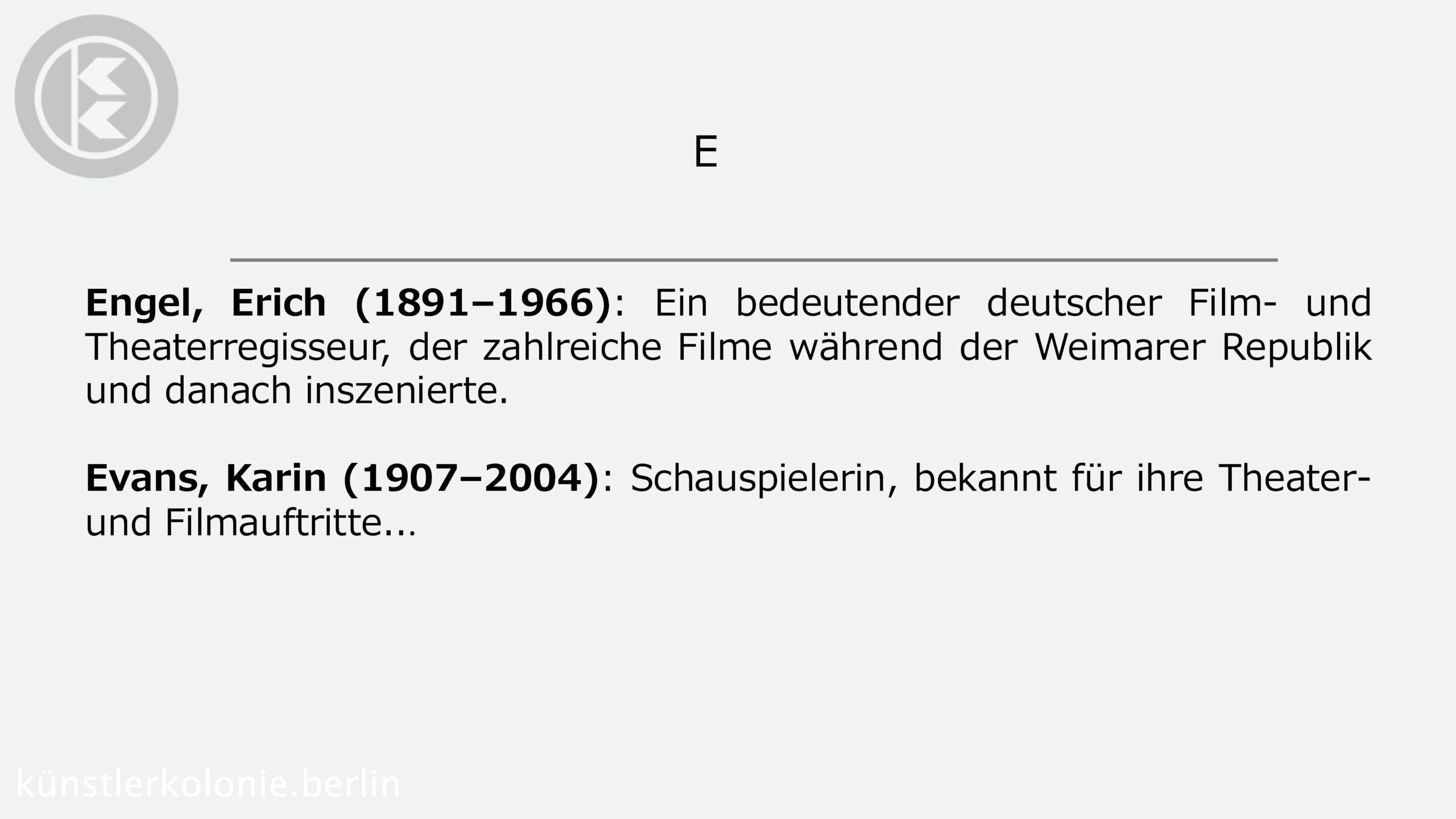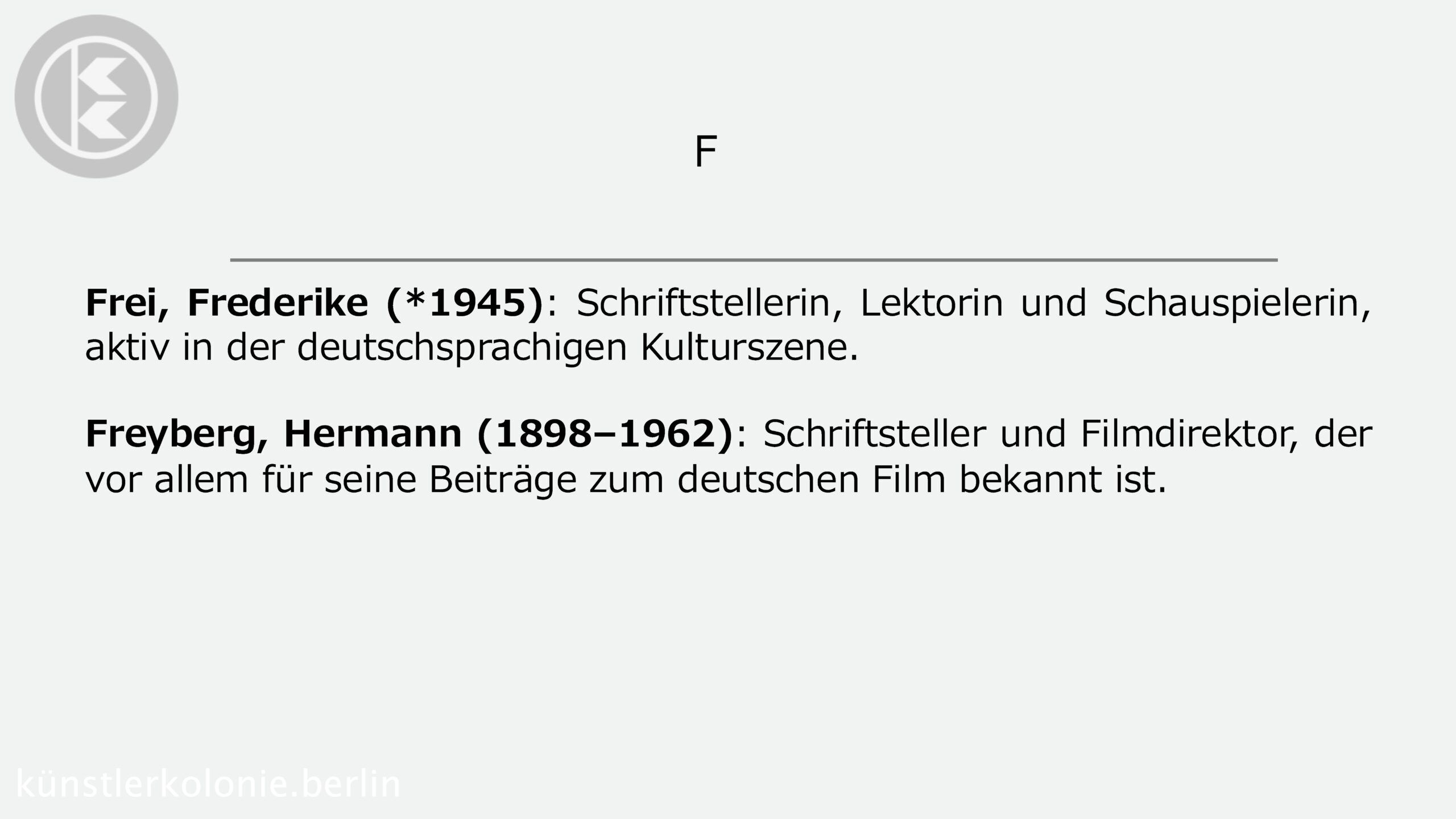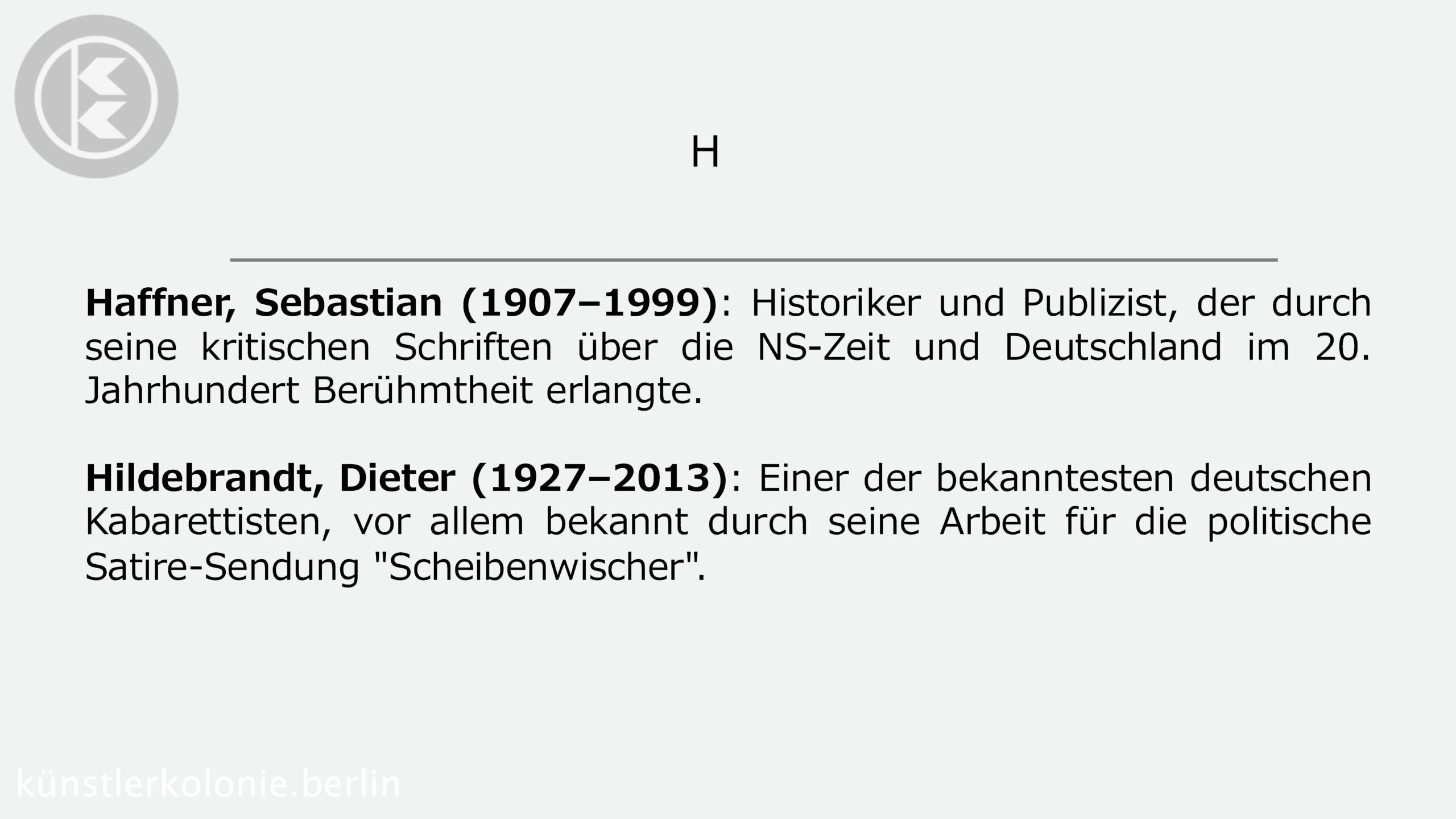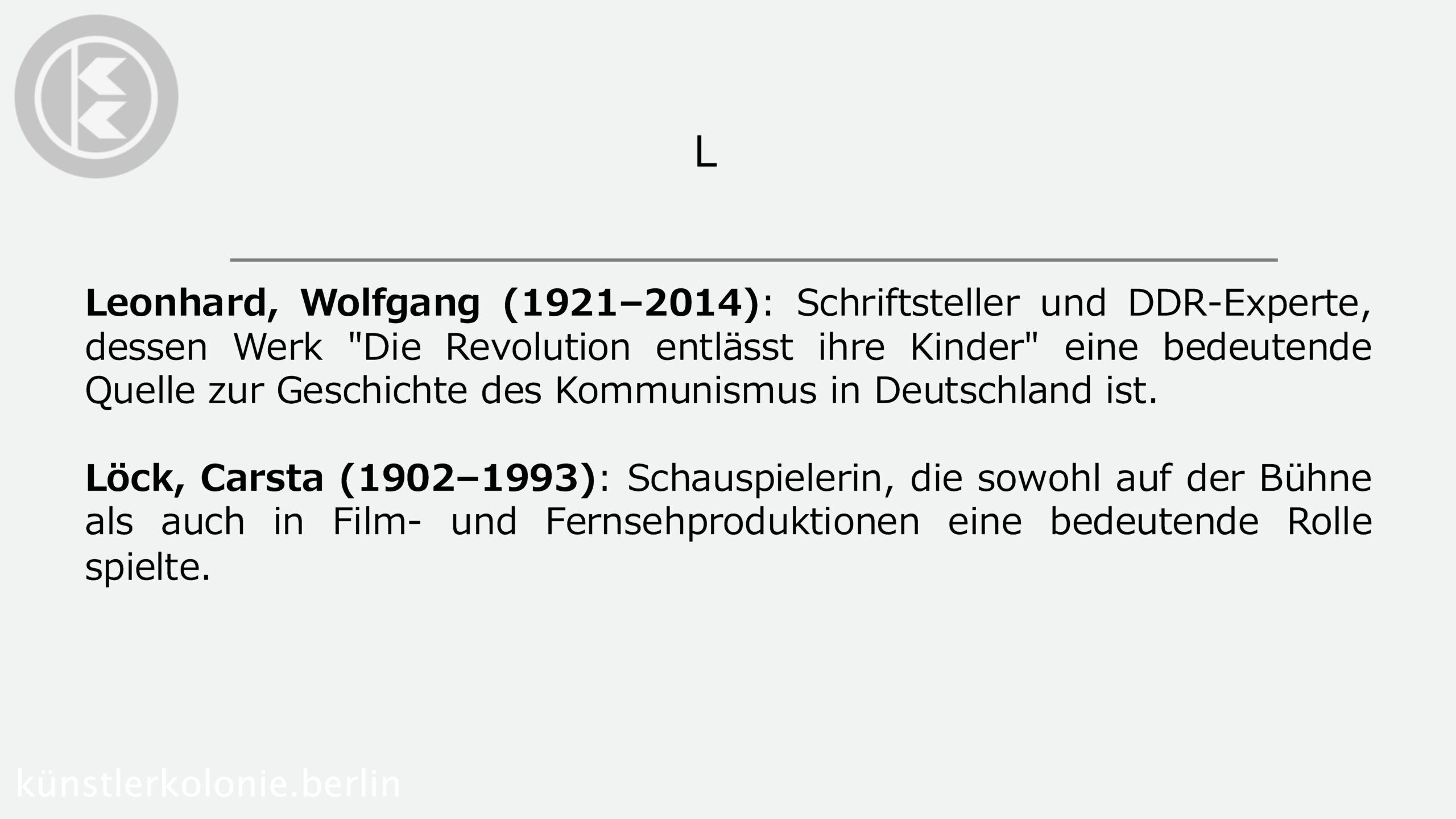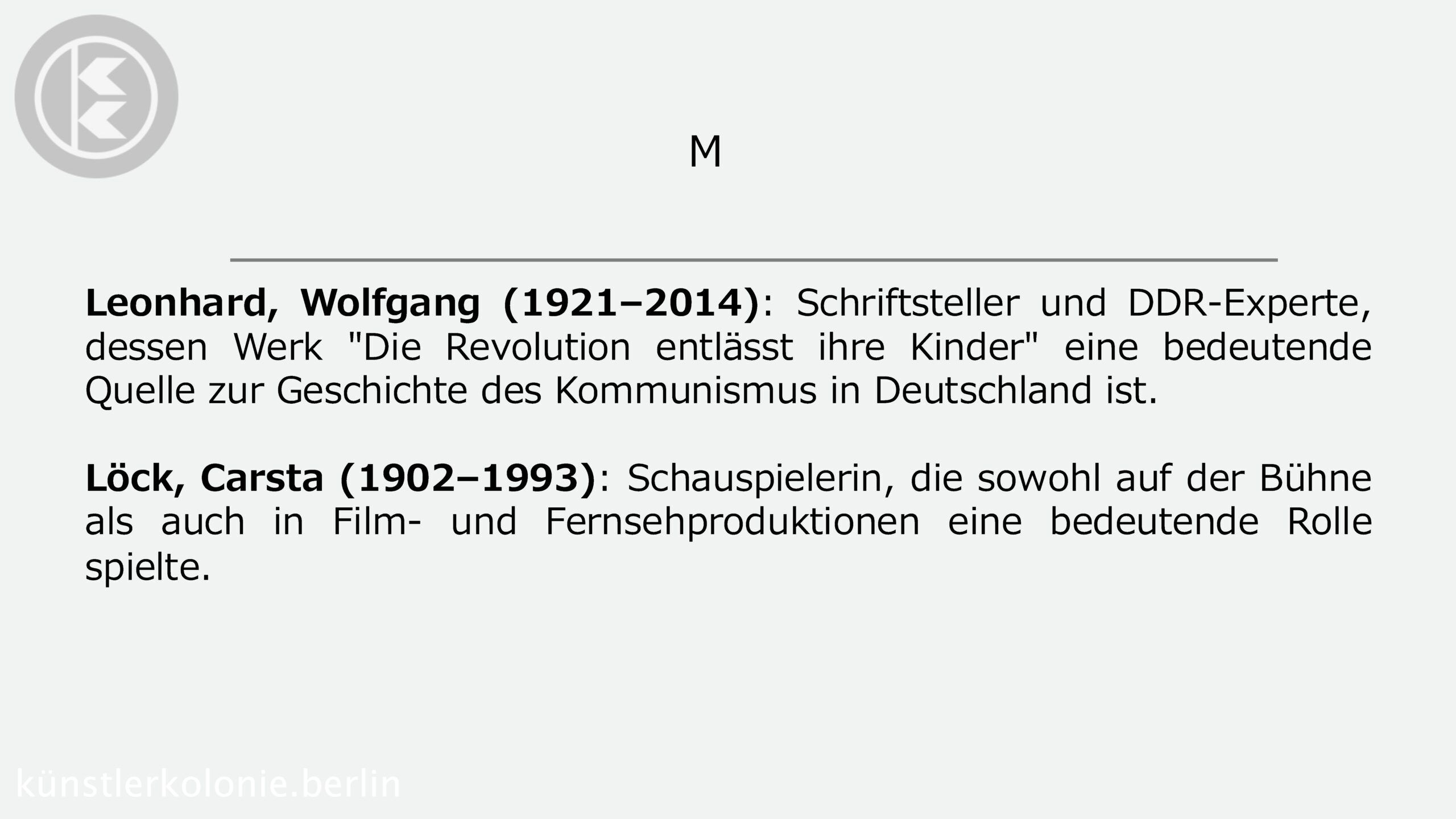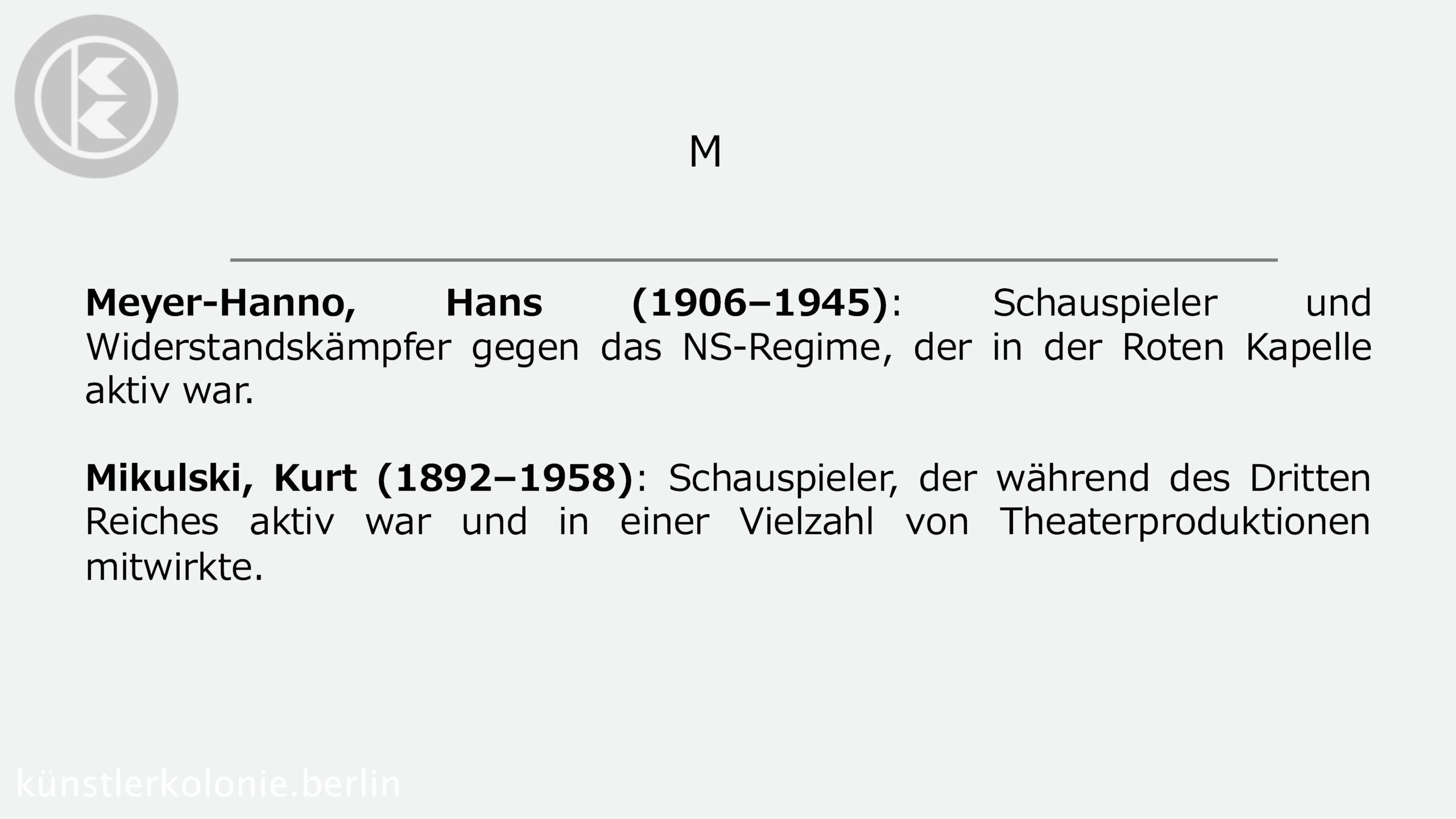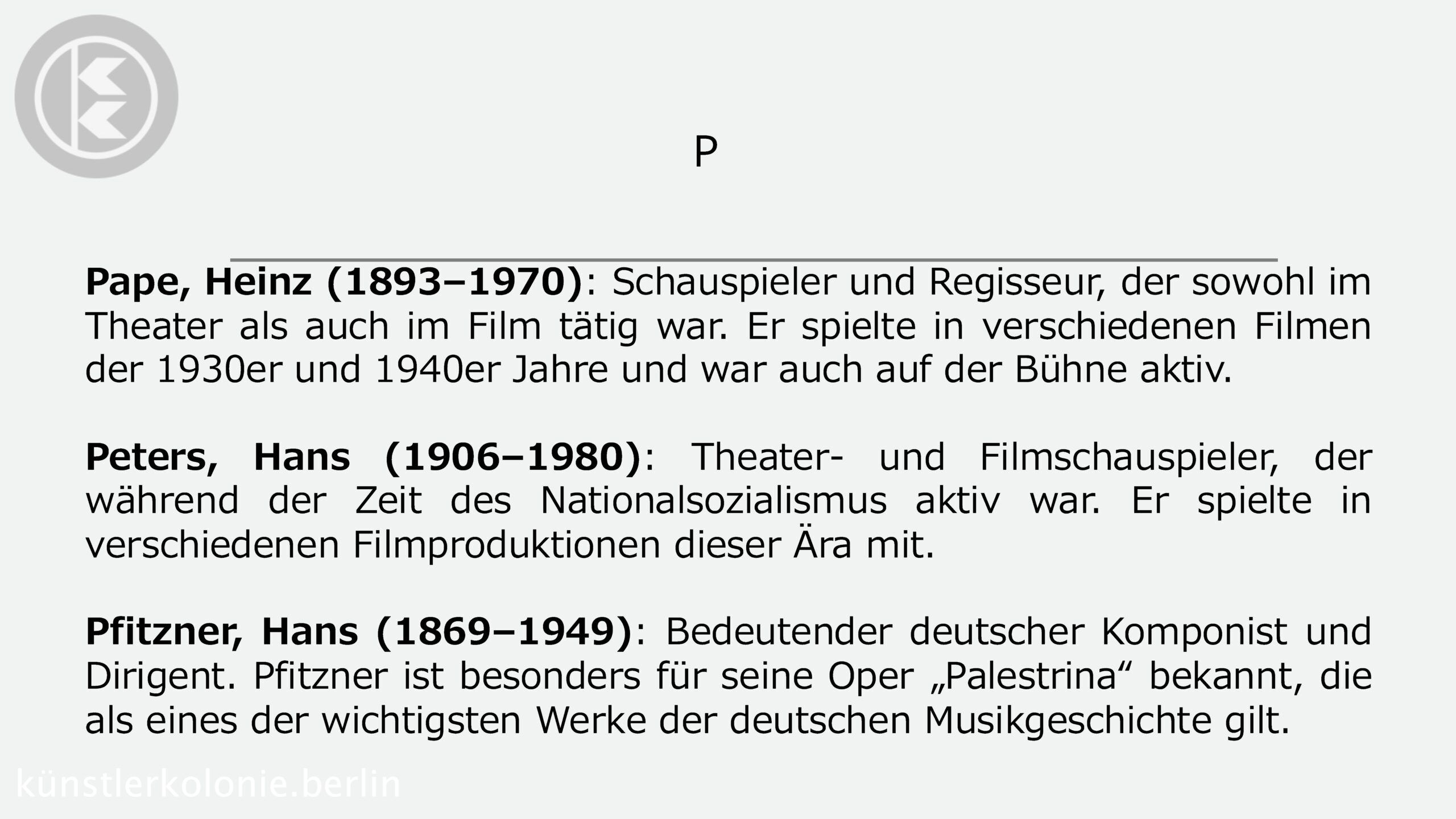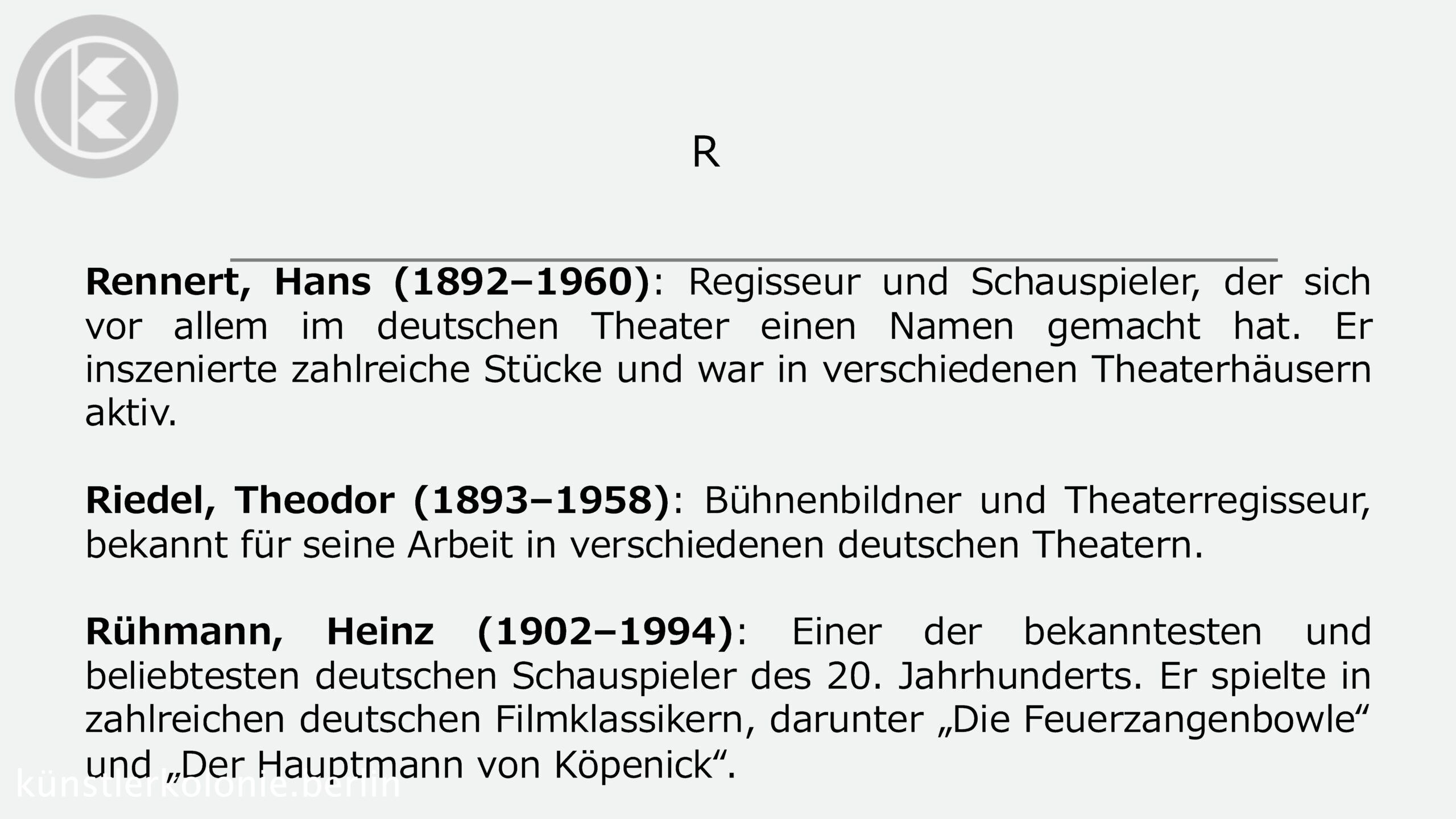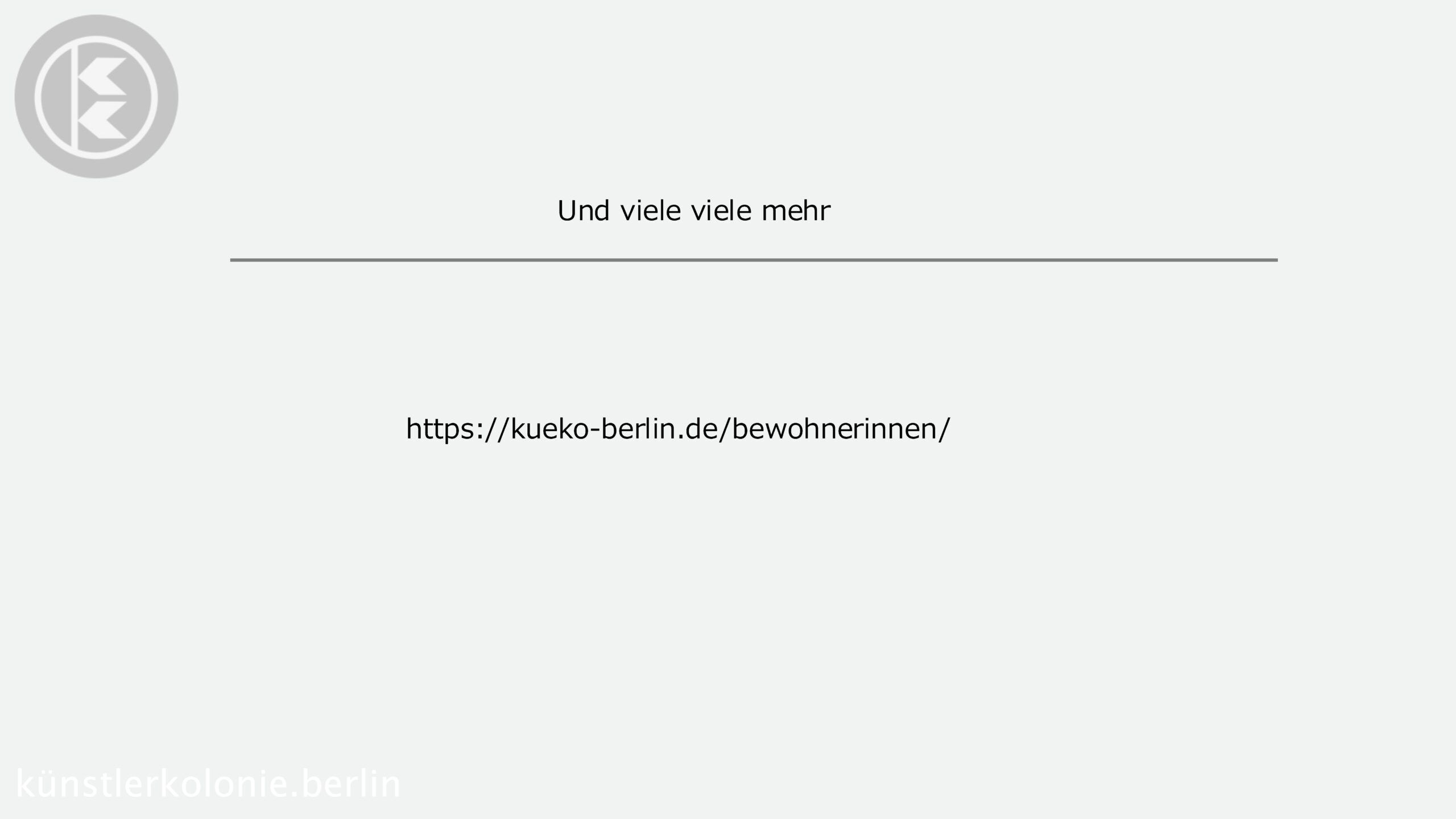Born in the USA
Zum 100. Jahrestag des Sturms auf die Bastille trafen sich am 14. Juli 1889 400 Delegierte sozialistischer Parteien und Gewerkschaften aus zahlreichen Ländern zu einem internationalen Kongress in Paris. Die Versammelten produzierten, wie auf Kongressen auch damals schon üblich, eine Menge bedruckten Papiers, darunter eine Resolution des Franzosen Raymond Felix Lavigne, in der es hieß:
„Es ist für einen bestimmten Zeitpunkt eine große internationale Manifestation zu organisieren, und zwar dergestalt, dass gleichzeitig in allen Städten an einem bestimmten Tage die Arbeiter an die öffentlichen Gewalten die Forderung richten, den Arbeitstag auf acht Stunden festzusetzen (…). In Anbetracht der Tatsache, dass eine solche Kundgebung bereits von dem amerikanischen Arbeiterbund (…) für den 1. Mai 1890 beschlossen worden ist, wird dieser Zeitpunkt als Tag der internationalen Kundgebung angenommen.“
Zunächst war keine Rede von einer Wiederholung oder gar einer Institutionalisierung als Feiertag. Es schien aber wie ein stillschweigendes Übereinkommen, dass die Arbeiterbewegungen der meisten Länder davon gleichwohl ausgingen. Wieso entschieden sich die amerikanischen Gewerkschaften für den 1. Mai?
Arbeitszeitverkürzung
Die Vorgeschichte begann zum Ende des Bürgerkriegs 1865, als die amerikanischen Gewerkschaften erstmals die Forderung nach der Einführung des Acht-Stunden-Tags erhoben. Bis in die 1860er Jahre galten in den meisten US-Betrieben Arbeitszeiten von elf bis 13 Stunden, erst dann konnten sie den Zehn-Stunden-Tag als Regelarbeitszeit durchsetzen. Es sollten weitere beinahe zwanzig Jahre vergehen, bis sie 1884 die allgemeine und verbindliche Durchsetzung einer täglich achtstündigen Arbeitszeit in Angriff nahmen. Sie beschlossen, am 1. Mai 1886 dafür einen mehrtägigen Generalstreik zu führen. Noch stand nicht der Termin, sondern die Forderung im Mittelpunkt.
Der Grund für die Terminwahl war ein völlig banaler und wenig zur Mythenbildung geeignet: Der 1. Mai galt in den USA traditionell als „Moving day“, als Stichtag für den Abschluss oder die Aufhebung von Verträgen, häufig verbunden mit Arbeitsplatz- und Wohnungswechsel. Der Acht- Stunden-Tag sollte in die neuen Verträge aufgenommen werden. Dafür traten am 1. Mai 1886 rund 400.000 Beschäftigte aus 11.000 Betrieben der USA in den Streik, aber nur für 20.000 Arbeiter konnte der Achtstundentag wirklich durchgesetzt werden. Diesen bescheidenen Erfolg überschatteten die Ereignisse in Chicago. Die Kundgebung am dortigen Haymarket endete in einem Desaster. Nach Darstellung der Polizei warfen Anarchisten eine Bombe auf die anwesenden Beamten, der sieben Polizisten zum Opfer fielen. Vier anarchistische Arbeiterführer wurden, obwohl keine Beteiligung am Anschlag nachgewiesen werden konnte, zum Tode verurteilt und gehenkt.
Der blutige Vorfall konnte den Kampf für den Acht-Stunden-Tag nur vorübergehend unterbrechen. Im Dezember 1888 erklärten die in St. Louis versammelten Gewerkschaftsdelegierten, unter ihnen zahlreiche deutschstämmige Einwanderer, am 1. Mai 1890 erneut Streiks und Kundgebungen durchzuführen. Die Bewegung war nicht auf die USA begrenzt, im selben Jahr forderten zum Beispiel auch die französischen Gewerkschaften die Einführung des Acht-Stunden-Tags.
Der 1. Mai im Deutschen Kaiserreich (1890-1918)
Der Beschluss des Pariser Kongresses, den Kampf um den Acht-Stunden-Tag als internationale Aktion zu führen, fiel mitten in die größte Streikwelle hinein, die das Deutsche Reich bis dahin erlebt hatte. Bis Dezember 1889 hatten 18 Gewerkschaften ihre Absicht erklärt, am kommenden 1. Mai zu streiken. Diese Erklärungen waren nicht unumstritten. Im Kaiserreich war die Streikneigung verglichen mit anderen Ländern eher gering. Das hatte nicht nur mit der Schwäche der Gewerkschaften oder dem kühleren Temperament des deutschen Michels zu tun. Als die Maifeier vorbereitet wurde, galt in Deutschland noch das Sozialistengesetz. Die sozialdemokratische Partei, der viele Gewerkschafter nahe standen, war zwar zu den Reichstagswahlen zugelassen, aber als Organisation verboten. Während der Vorsitzende August Bebel im Reichstag Reden hielt, musste die Parteizeitung Vorwärts in Schweizer Käse verpackt über die Grenze geschmuggelt werden.
Die Unternehmerverbände drohten für den Fall von Streiks am 1. Mai mit Aussperrungen, Entlassungen und Schwarzen Listen. Wer darauf geriet, brauchte sich in seiner Gegend um Arbeit nicht mehr zu bemühen. Nur wenige Unternehmer, wie der Fabrikant Heinrich Freese oder Ernst Abbe (Zeiss Jena), der 1900 den 1. Mai als bezahlten (zunächst halben) Feiertag einführte, waren um sozialen Ausgleich und Deeskalation des Klassenkonflikts bemüht. Sie nahmen es mit der Arbeitsruhe am 1. Mai nicht so genau oder feierten gar mit.
DGB ein Maienkind
Trotz drohender Sanktionen beteiligten sich am 1. Mai 1890 in Deutschland etwa 100.000 Arbeiterinnen und Arbeiter an Streiks, Demonstrationen und sogenannten „Maispaziergängen“. Die regionalen Schwerpunkte bildeten Berlin und Dresden, aber auch Hamburg, wo es zu einem besonders erbitterten Arbeitskampf mit zeitweise 20.000 Beteiligten kam. Die Auseinandersetzungen zogen sich dort bis in den Spätsommer hin. Das war nur deshalb möglich, weil die Gewerkschaften die Aktionen an allen anderen Orten nach und nach aufgaben, um sich auf Hamburg konzentrieren zu können.
Es gelang ihnen zwar, das Koalitionsrecht zu sichern. Die im internationalen Vergleich bescheidene Forderung nach einem Neun-Stunden-Tag ließ sich jedoch nicht durchsetzen. Es blieb, wie in den meisten anderen kapitalistischen Ländern, zunächst bei zehn Stunden als Regelarbeitszeit. Ein „Nebenprodukt“ des Streiks resultierte aber aus der Erfahrung gemeinsamer Aktion. Sie bewog die Vertreter der Gewerkschaften zur Gründung eines Dachverbandes, der noch 1890 als „Generalcommission der Gewerkschaften Deutschlands“ unter Führung Carl Legiens in’s Leben trat: Die Geburtsstunde des Deutschen Gewerkschaftsbundes.
Die Sozialdemokratische Partei (SPD), gerade wieder zugelassen, beschloss auf ihrem Hallenser Parteitag im Oktober 1890, den 1. Mai als dauerhaften „Feiertag der Arbeiter“ einzuführen. Um der Provokation die Spitze zu nehmen, wollte sie von Arbeitsruhe dort absehen, wo sich ihr Hindernisse in den Weg stellten. Partei und Gewerkschaften machten den Aufruf zum Streik von der wirtschaftlichen Lage des jeweiligen Betriebs abhängig. Wo er nicht möglich war, sollten am ersten Maisonntag Umzüge und Feste im Freien stattfinden.
mit dem Ersten Weltkrieg brach die Sozialistische Internationale auseinander. Die SPD entschied sich wie ihre Schwesterparteien in den meisten anderen Ländern für ihr Vaterland und gegen Lohnbewegungen und Maikundgebungen. Die daraus resultierenden Konflikte zerrütteten die Familienverhältnisse in der Arbeiterbewegung. Auch die deutsche Sozialdemokratie zerbrach. Nach Kriegsende gab es zwei sozialdemokratische und eine kommunistische Partei (KPD), deren Vorläufer, der Spartakusbund, gegen den Krieg auftrat und bereits seit 1916 wieder zu Streiks und Maidemonstrationen aufrief.
Der 1. Mai verliert seine Unschuld (1919-1932)
Das Schicksal des 1. Mai und des Acht-Stunden-Tags in der Weimarer Republik war so wechselhaft, wie deren Geschichte. Der Rat der Volksbeauftragten, eine seit November 1918 amtierende kommissarische Revolutionsregierung aus SPD und Unabhängiger Sozialdemokratischer Partei (USPD), dekretierte als eine der ersten Amtshandlungen die Arbeitszeitverkürzung auf acht Stunden täglich. Den 1. Mai erklärte die Nationalversammlung im April 1919 zum gesetzlichen Feiertag. Das Gesetz war aber auf den 1. Mai 1919 begrenzt, die spätere Regelung sollte in eine internationale Lösung eingebunden werden und nach Friedensschluss und Verabschiedung der Verfassung erfolgen.
Versuche des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) und der SPD, den Tag der Arbeit über 1919 hinaus als gesetzlichen Feiertag zu sichern, blieben vergeblich. Lediglich in den Ländern Braunschweig, Lübeck, Sachsen und Schaumburg-Lippe hatte er nach 1922 Bestand. Die bürgerlichen Parteien argumentierten, dass der Feiertag einer einzelnen gesellschaftlichen Gruppe nicht allgemein verbindlich für die ganze Gesellschaft sein könnte. Aus diesem Grund hatte die SPD 1919 bei den Verhandlungen in der Nationalversammlung dafür plädiert, aus dem Kampftag des Proletariats einen allgemeinen Volksfeiertag zu machen, um, so Reichsminister Eduard David (SPD), ihren Willen zur Klassenversöhnung zu dokumentieren. Viele Unternehmer begriffen Maifeiern aber nach wie vor als Provokation. So fielen die klassenkämpferischen Parolen im „Arbeitgeber“, dem Zentralorgan der Unternehmerverbände, auf fruchtbaren Boden: „Auch in der Republik gilt der 1. Mai der Propaganda des Umsturzes, der Beseitigung des Privateigentums und der Errichtung der proletarischen Diktatur. Gleichgültigkeit gegenüber der Maifeier bedeutet Kapitulation vor dem Marxismus.“ (zitiert nach Schuster 1991, S. 63.)
„Blutmai“ 1929
In der Arbeiterbewegung selbst war die Frage, ob und wie der 1. Mai zu begehen sei, sehr umstritten. Die christlichen Gewerkschaften, seit Anfang des 20. Jahrhunderts mit einem eigenen interkonfessionellen Dachverband vertreten, lehnten die „marxistische Heerschau“ ab. Ansonsten waren sie aber kaum weniger streikbereit und traten aktiv für die Interessen der Arbeiter in Fragen der Arbeitszeit und des Arbeitsschutzes ein. Die Spaltung der sozialistischen Arbeiterbewegung zog auch die „Spaltung“ ihres höchsten Feiertags nach sich. Während die Kommunisten stärker den Kampfcharakter akzentuierten, begingen ihn die Sozialdemokraten eher als Festtag.
Einen traurigen Höhepunkt der Konflikte zwischen SPD und KPD bildete der 1. Mai 1929. Karl Zörgiebel, der sozialdemokratische Polizeipräsident von Berlin, hatte wegen befürchteter Unruhen ein Demonstrationsverbot über die Stadt verhängt. Die KPD ignorierte das Verbot und veranstaltete Demonstrationen, in deren Verlauf es zu wilden Schießereien kam. Dabei wurden 28 Personen getötet, darunter auch völlig Unbeteiligte. Der Tag ging als „Blutmai“ in die Geschichte ein und steht symbolisch für die tiefe Zerrissenheit der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik. Aber es sollte noch schlimmer kommen.
„Tag der Nationalen Arbeit“ (1933-1945)
Der „Schwarze Freitag“, der New Yorker Börsenkrach vom Oktober 1929, zog die deutsche Wirtschaft tief in den Abgrund. Bis 1932 entwickelte sich ein Arbeitslosenheer von über sechs Millionen Menschen. Das entsprach einer Arbeitslosenquote von in der Spitze 33 Prozent – vor dem Hintergrund einer noch unzureichend entwickelten Arbeitslosenversicherung. Die Grundlagen der parlamentarischen Demokratie waren bereits 1930 ausgehöhlt, seitdem vom Reichspräsidenten ernannte sogenannte „Präsidialkabinette“ auf der Grundlage von Notverordnungen an den parlamentarischen Mehrheiten vorbei regieren konnten.
Die Gewerkschaften, fast 44 Prozent ihrer Mitglieder waren arbeitslos, sahen sich in der Defensive. Ihre Vorstände wollten sich selbst dem Kabinett Hitler noch als unpolitische Fachvereine zur Vertretung ausschließlich beruflicher Interessen andienen. Der misstraute ihnen jedoch. Er brauchte sie auch nicht, wohl aber ihre Mitgliederbasis. Der Integration der Arbeiter in die nationalsozialistische „Volksgemeinschaft“ maßen die Nationalsozialisten höchste Priorität zu, eine Schlüsselrolle hierbei sollte die Maifeier 1933 einnehmen. Mitte April 1933 notierte Goebbels in „Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei“: „Den 1. Mai werden wir zu einer grandiosen Demonstration deutschen Volkswillens gestalten. Am 2. Mai werden dann die Gewerkschaftshäuser besetzt. Gleichschaltung auch auf diesem Gebiet (…). Es wird vielleicht ein paar Tage Krach geben, aber dann gehören sie uns.“ Im April 1933 erklärte Hitler den 1. Mai zum „Feiertag der nationalen Arbeit“.
Tragische Fehleinschätzung
In ihren internen Lageeinschätzungen zu Beginn des NS-Regimes gingen die Gewerkschaftsführungen davon aus, dass nun etwas ähnliches zu erwarten sei, wie unter dem Sozialistengesetz. Sie glaubten immer noch, ihre Verbände als unpolitische berufsständische Organisationen durch eine, wie allgemein angenommen wurde, kurze Zeitspanne der NSDAP-Herrschaft lavieren zu können. Man rechnete mit „Schutzhaft“ und Zuchthausstrafen, zum Teil waren sie schon in Kraft und waren auch Gewerkschafter betroffen: Eine tragische Fehleinschätzung, wie sich schon am 2. Mai zeigte. Hitler ließ die Gewerkschaften zerschlagen, ihre Häuser von SA- und SS-Trupps besetzen und zahlreiche Funktionäre verhaften.
Der 1. Mai überlebte im Gegensatz zu seinen früheren Protagonisten die Hitlerzeit zweifellos auch deshalb, weil er dem Regime als hervorragende Kulisse für Paraden, Aufmärsche und Leistungsschauen der deutschen Industrie diente. Die pathetische Inszenierung von Massenauftritten haben die Nationalsozialisten zwar nicht erfunden, aber sie haben die, wie Walter Benjamin es nannte, Ästhetisierung der politischen Macht zu ungeahnten Höhepunkten weiterentwickelt. Die Usurpation des alten Feiertags der Arbeiterbewegung war sehr weitgehend, vollständig ist sie den Nationalsozialisten allerdings nie gelungen. Der 1. Mai war bis 1945 immer wieder Anlass für Aktionen von Oppositionellen. Sie traten mit symbolträchtigen, oft waghalsigen Aktionen an die Öffentlichkeit. Noch im Sommer 1933 fällten Unbekannte die von Hitler am 1. Mai auf dem Tempelhofer Feld in Berlin gepflanzte Eiche.
Feiern zwischen Trümmern (1946-1948)
1945 konnten an einigen von den alliierten Streitkräften bereits besetzten Orten die ersten freien Maifeiern seit 13 Jahren stattfinden, organisiert von überlebenden Sozialdemokraten, Kommunisten und Gewerkschaftern. Aber noch gab es an vielen Orten Kampfhandlungen, noch hatte die Wehrmacht nicht kapituliert. Diese Feiern fanden nur im kleinen Rahmen statt, denn die meisten Deutschen hatten anderes im Sinn, als Demonstrationen oder gar Streiks, die die Besatzer ohnehin nicht erlaubt hätten. Sie kämpften um das nackte Überleben, hungerten und hausten zwischen Trümmern.
Im April 1946 bestätigte der alliierte Kontrollrat den 1. Mai als Feiertag. Dennoch trauten die Besatzungsmächte den Deutschen immer noch nicht hundertprozentig, so durften auf Anordnung der amerikanischen Militärverwaltung bei den Umzügen keine Fahnen und Transparente mitgeführt werden. Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund (FDGB) in der sowjetischen Zone hatte es da leichter, aber in einem Punkt glichen sich alle Maiumzüge in Deutschland und entsprachen dem Bild, das dem Berichterstatter des Weser-Kuriers auf der Bremer Maidemonstration auffiel: Männer in den Altersgruppen zwischen zwanzig und vierzig fehlten fast völlig. Wer nicht tot oder verwundet war, befand sich in Kriegsgefangenschaft oder irrte auf der Suche nach seinen Angehörigen quer durch Deutschland.
Bruch zwischen Ost und West
Die Entwicklung in Ost und West verlief bald in sehr unterschiedliche Richtungen, wie schon die Berliner Maikundgebungen 1946 deutlich zeigten. Die SPD in den westlichen Zonen der geteilten Stadt hatte sich im April der Zwangsvereinigung mit der KPD zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) erfolgreich widersetzt. Sie organisierte in den Bezirken Spandau, Neukölln und Schöneberg eigene Demonstrationen, alternativ zu der sehr stark von der SED dominierten Gesamtberliner Veranstaltung.
Dennoch hatten viele Berliner die Hoffnung noch nicht aufgegeben, bald wieder gemeinsame Kundgebungen durchführen zu können. Viele Deutsche hofften noch auf die Möglichkeit einer gesamtstaatlichen Entwicklung. Im Frühjahr 1948 war aber endgültig klar, dass es eine solche nicht mehr geben würde. Die ehemals verbündeten Siegermächte USA und UdSSR waren zu Feinden im „Kalten Krieg“ geworden und bezogen ihre jeweilige Besatzungszone fest in den eigenen Bündnisbereich mit ein.
Erster Mai in der DDR (1949-1989)
„Vorschlag für den Ersten Mai: Die Führung zieht am Volk vorbei“ skandierten vor mehr als zehn Jahren unzufriedene DDR-bürger. Nicht lange davor war am 1. Mai 1989 noch die halbe DDR auf den Beinen und defilierte vor der Führung. Erich Honecker winkte gutgelaunt zurück und ließ sich von Jungen Pionieren Blumensträuße und Selbstgebasteltes überreichen.
Der 1. Mai war seit der Verabschiedung der ersten Verfassung der DDR 1949 staatlich garantierter Feiertag, nicht mehr Teil einer Gegenkultur und Gegenöffentlichkeit. Am 1. Mai 1951 zog man vom Ostberliner Lustgarten auf den einstigen Schlossplatz, der inzwischen auf die Namen von Marx und Engels umgetauft war und von nun an zum zentralen Kundgebungsplatz wurde. Anders als im Westen Deutschlands wurde der Tag der Arbeit zum staatlich verordneten Ritual, mit dem die Führung auch eine Verbesserung ihrer Legitimation erstrebte. Deutlich wurde das in dem Versuch, wirtschaftliche Erfolge herauszustellen. Die Arbeiter mussten geloben, mehr zu produzieren und besser zu arbeiten. Nicht mehr der Kampf um soziale und politische Rechte, sondern das Bemühen um wirtschaftlichen Fortschritt stand im Mittelpunkt der Kundgebungen
Militärparaden
Seit 1956 wurden die Ostberliner Maifeiern mit einer Militärparade nach sowjetischem Vorbild eröffnet. Der Aufmarsch der „gepanzerten Faust der Arbeiterklasse“ veränderte das äußere Bild der Maifeiern total. Die Partei- und Staatsführung nahm die Parade von der Balustrade des Volkskammergebäudes hoch über den Köpfen der ostdeutschen Bevölkerung ab. Erst nachdem USA und UdSSR den Kalten Krieg überwunden hatten, verzichtete die SED-führung ab 1977 auf das militärische Ritual. Die Ehrentribüne ließ sie absenken, so dass auch wieder ein engerer Kontakt mit der Bevölkerung möglich war und Hände geschüttelt werden konnten.
Mit solchen Gesten allein konnte die Entfremdung zwischen Volk und Führung in der DDR allerdings nicht überwunden werden. 1988 wurde die Maikundgebung deshalb zur geschlossenen Gesellschaft, denn aus Angst vor oppositionellen Spruchbändern und Demonstrationen ließ die Partei die Straßenzüge um die Karl-Marx-Allee großräumig von Kampfgruppen und FDJ abriegeln. Das Schauspiel wiederholte sich in ähnlicher Form am 1. Mai 1989, nur dass das offizielle Maikomittee diesmal mit Blick auf die Demokratisierungsbemühungen Gorbatschows in der Sowjetunion auf den üblichen Maigruß an alle „Bruderländer“ verzichtete.
Der 1. Mai in der Bundesrepublik (1949-1989)
Seit der Gründung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) 1949 zeichnete der geschäftsführende Bundesvorstand für die Maifeiern verantwortlich und beschloss die Maiaufrufe und die zentralen Maiparolen. 1951 begründete er die Tradition, die politischen Kundgebungen mit kulturellen Veranstaltungen zu umrahmen. Aus einer zunächst schlichten Feierstunde entwickelte sich später eine Mairevue, auf der der DGB- Vorsitzende zwischen künstlerischen Darbietungen die gewerkschaftlichen Forderungen erläuterte. Diese Veranstaltungen wurden von den Rundfunkanstalten der ARD, später von den dritten Fernsehprogrammen übertragen bzw. in Ausschnitten gesendet.
Aber auch die Kulturveranstaltungen und die mediale Präsenz konnten nicht verhindern, dass sich seit Mitte der fünfziger Jahre ein deutlicher Trend zu sinkenden Teilnehmerzahlen einstellte. Selbst die Gewerkschaftsmitglieder begriffen den 1. Mai zunehmend weniger als Kampf- oder Feiertag der Arbeit, sondern vielmehr als Angebot zur individuellen Freizeitgestaltung. Der DGB versuchte, diesem Trend durch attraktive Massenveranstaltungen im Anschluss an die Kundgebungen entgegenzuwirken. Seit Ende der sechziger Jahre war tatsächlich wieder eine Zunahme zu verzeichnen. Das hing mit der Neugestaltung der Maifeiern, aber auch mit den verschlechterten gesamtwirtschaftlichen Eckdaten zusammen. 1966/67 brach die erste Nachkriegsrezession über die Bundesrepublik herein.
Neue soziale Bewegungen
Nicht nur wirtschaftlich und politisch, auch gesellschaftlich standen die Signale auf Veränderung, wie nicht zuletzt die Maifeiern in den späten sechziger und frühen siebziger Jahren dokumentierten. Neben den Gewerkschaften führten auch andere Gruppen Kundgebungen durch oder chaotisierten die offiziellen DGB-Feiern: So geschehen 1977 in Hamburg und Frankfurt, aber auch in anderen Städten wie Bremen und Berlin, wo sie aufgrund oppositioneller Störmanöver mehrere Jahre nur noch im Saal stattfanden. Bis zu den achtziger Jahren gelang es aber nach und nach, die Kluft zwischen der „alten“ Arbeiterbewegung und den neuen sozialen Bewegungen zu verringern. Es wurde üblich, am 1. Mai erst zur DGB- Veranstaltung und anschließend zum alternativen Stadtteilfest zu gehen.
Der 1. Mai hatte von dieser Art Frühlingsknospen freilich wenig, denn der Trend zu rückläufigen Teilnehmerzahlen an den Kundgebungen setzte wieder ein. Anders als in früheren Zeiten gelang es dem DGB nicht mehr ohne weiteres, die sich verschärfenden Tarifauseinandersetzungen oder die Kampagnen für die 35-Stunden-Woche und gegen den Streikparagraphen 116 (Arbeitsförderungsgesetz) zu einer stärkeren Mobilisierung zu nutzen. Das Ende des 1. Mai, gleich ob als Kampf- oder als Feiertag der Arbeitnehmer, schien nahe. Auch innerhalb der Gewerkschaften sahen manche, wie die Ötv-Chefin Monika Wulff-Matthies, die einzige Überlebenschance in der Umwidmung in eine Art Volksfest für die ganze Familie.
Der 1. Mai im vereinten Deutschland
Volksfest, Kampftag oder Feiertag, diese Überlegungen gerieten schnell in den Hintergrund, als 1989/90 ganz andere Ereignisse die Aufmerksamkeit der Gewerkschaften in Anspruch nahmen. Beinahe über Nacht hatte sich mit dem Zusammenbruch des Sozialismus die Welt verändert. Dem DGB- Vorsitzenden Ernst Breit hielt 1990 vor dem Berliner Reichstag die erste freie gewerkschaftliche Mairede an ein gesamtdeutsches Publikum seit 1932, seit beinahe 60 Jahren. Zugleich handelte es sich um den 100. Jahrestag des 1. Mai, eine wahrhaft historische Situation vor passender Kulisse.
Zunächst bescherte die staatliche Einheit der (west-)deutschen Wirtschaft einen Boom. Mahnende Stimmen, dass die überhastete Einführung der Marktwirtschaft und der DM die Absatzmärkte der DDR-Industrie wegbrechen lassen würde, wischte Kanzler Helmut Kohl hinweg: In wenigen Jahren entstünden in den neuen Bundesländern „blühende Landschaften“. Wie sich bald zeigte, war der Gang zum Arbeitsamt das einzige, was vielen Ostdeutschen blühte. Nachdem der anfängliche Boom in eine Rezession umschlug, wurde deutlich, dass die ostdeutschen Länder über lange Jahre hinweg auf Hilfe aus dem Westen angewiesen sein würden.
Teilen verbindet
Vor diesem Hintergrund entschloss sich der DGB, den 1. Mai 1992 unter das Motto „Teilen verbindet“ zu stellen. Dieses Motto und die dahinter stehenden Gedanken stießen innerhalb der Gewerkschaften auf ein sehr geteiltes Echo. Viele Kritiker lehnten es als zu defensiv ab. Nach ihrer Meinung belastete die Bundesregierung die Arbeitnehmer mit den Kosten der Einheit im Vergleich zu Selbständigen unverhältnismäßig. Solidarisches Teilen sei Sache der gesamten Gesellschaft, nicht bloß einzelner Gruppen.
In den neunziger Jahren verfestigte sich für kritische Beobachter der Eindruck, als sei der Gedanke solidarischen Teilens völlig in den Hintergrund getreten. So nahm IG Metall-Chef Klaus Zwickel den 1. Mai 2000 zum Anlass, an die Sozialpflichtigkeit des Eigentums zu erinnern und einzufordern, dass ihr ein höherer Stellenwert als dem Shareholder-Value eingeräumt wird. Papst Johannes Paul II. forderte, die Menschen müssten endlich wieder den ersten Platz in der Wertehierachie der Arbeitswelt einnehmen.
Am Beginn des 21. Jahrhunderts stehen die Gewerkschaften vor großen Herausforderungen. Mit der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ist das organisatorische Fundament für den Übergang von der Industrie- in die Dienstleistungsgesellschaft gelegt. Auch die Gewerkschaftsbewegung der Zukunft wird auf Symbole nicht verzichten können. Der Tag der Arbeit spielt hier eine wichtige Rolle.
Er bietet nach wie vor gute Möglichkeiten zur Selbstdarstellung und Ansprache an ein breites Publikum. Das spricht nicht gegen seine Modernisierung. Phantasievolle Aktionen, wie die Schweriner Jobparade und der Berliner Inlineskater-Block vom 1. Mai 2000 können dabei helfen, die Ideen Raymond Felix Lavignes und seiner Mitstreiter auch nach über 110 Jahren an die nachfolgende Generation weiterzugeben.
Literaturauswahl zur Geschichte des 1. Mai
- Udo Achten, Wenn ihr nur einig seid: Texte, Bilder und Lieder zum 1. Mai, Köln 1990.
- Udo Achten/ Matthias Reichelt/ Reinhard Schulz, Mein Vaterland ist international. Internationale Illustrierte Geschichte des 1. Mai 1886 bis heute, Oberhausen 1986.
- Horst Dieter Braun/ Claudia Reinhold/ Hanns-A. Schwarz (Hg.), Vergangene Zukunft. Mutationen eines Feiertags, Berlin 1991.
- Dieter Fricke, Kleine Geschichte des Ersten Mai. Die Maifeier in der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung, Frankfurt/M. 1980.
- Inge Marßolek (Hg.), 100 Jahre Zukunft. Zur Geschichte des 1. Mai, Frankfurt/M./Wien 1990.
- Dieter Schuster, Zur Geschichte des 1. Mai in Deutschland, Düsseldorf 1991.
© www.dgb.de
Views: 428