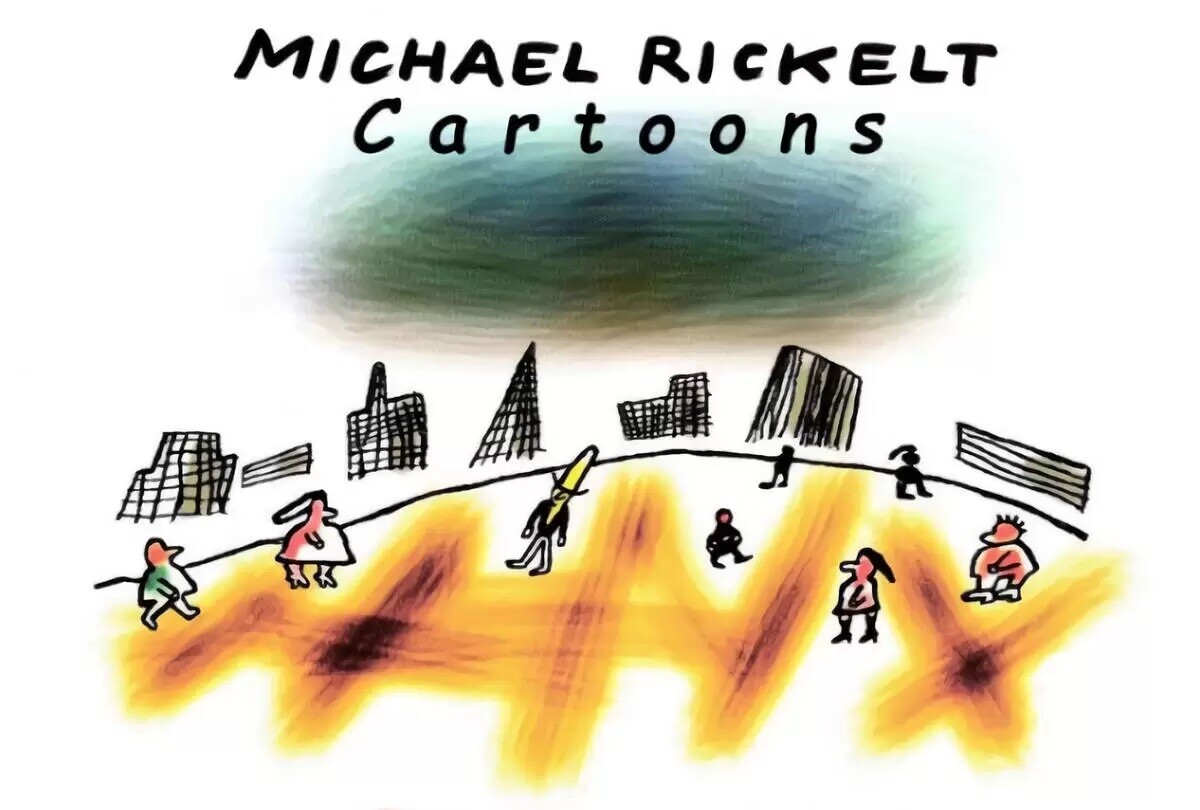Camilla Spira und ihre Schwester Steffie
Die Spira-Schwestern stellen als Zeuginnen des Zwanzigsten Jahrhunderts die Unterschiedlichkeiten von Exilerlebnissen in ein besonderes Licht. Aus der selben Familie stammend, sind ihre Geschichten, wie sie verschiedener kaum sein können.
Camilla Spira wird am 1. März 1906 in Hamburg, Steffie am 02. Juni 1908 in Wien geboren. Ihre Eltern sind der in Deutschland bekannte Opernsänger Fritz Spira, aus einer jüdischen Familie in Wien gebürtig, und die aus Dänemark stammende Protestantin Lotte Andresen, die später als Filmschauspielerin arbeiten wird.
Der charmante Vater mit dem Wiener Akzent, der Erfolge am Theater und im Kabarett feiert, läßt seinen Töchtern eine unkonventionelle Erziehung angedeihen. Er ist jemand, der öfter sein Geld verspielt und gelegentlich verlangt, auf der Stelle mit den Kindern spontan zu verreisen, gleichgültig, ob gerade Ferien sind oder nicht.
Es ist die Mutter, die dann die Lehrer becirct und aus der Schule holt, um diese Familientage zu ermöglichen. So bunt und abwechslungsreich sieht der Familienalltag bei den Spiras aus. Der Vater ist in seinen Aktionen und Entscheidungen unberechenbar bis jähzornig, die Mutter organisiert den Rest, ohne jedoch ihr Bedürfnis nach Amusement zu vernachlässigen. Darüber hinaus ist Lotte Andresen diejenige, die die Töchter anleitet, einige schauspielerische Szenen im privaten Kreis vorzuführen, und so gestalten sie einen Großteil ihrer Freizeit mit Verkleidungen und Sketchen.

Die Schauspielerkinder wachsen zusammen in der Koblenzer Strasse in Berlin auf. Camilla, die ältere, wird zärtlich „Millachen“ gerufen. Sie ist bis ins hohe Alter hinein stets auf ihr Äußeres bedacht, und legt Wert auf Anstand und Etikette. Steffie hingegen ist das krasse Gegenteil ihrer Schwester. Es macht ihr nie etwas aus, mit dem Hinweis auf das gesittete Auftreten Camillas zurechtgewiesen zu werden. Wie ihre Kleidung aussieht, ist ihr „von jeher wurscht“, und sie kommt als Kind wesentlich besser als Camilla damit zurecht, durch die abenteuerlichen Eskapaden, in die sie der Vater hineinzieht, auch einmal neben der Normalität einer bürgerlichen Familie zu leben.
Bereits als Fünfzehnjährige sagt Camilla Spira, so berichtet ihre Schwester, „Also weißt du, ich werde nur ganz reich heiraten, damit mir so etwas nicht passiert.“ So unangenehm ist ihr schon als Kind die wirtschaftlich unsichere Situation der Familie, welche sich auch darin zeigt, daß man gelegentlich beim Einkaufen anschreiben lassen muß.
Um Malerin werden zu können, stellt Camilla Spira schon mit 13 Jahren eine Mappe zu sammen, mit der sie sich bei der Akademie der Künste in Berlin bewirbt. Es wird ihr zwar Begabung attestiert, aber um aufgenommen zu werden, ist sie zu jung. Statt dessen organisiert ihr Vater ihr über Beziehungen einen Platz in der legendären Max Reinhardt Schule für Schauspiel. Nachdem sie sechs Monate dort verbracht hat, bekommt sie ihr erstes Engagement am „Wallner Theater“ in Berlin. Hier spielt sie unter anderem die klassischen Rollen der Emilia Galotti und Minna von Barnhelm. Ihre Auftritte sind sehr überzeugend und erhalten gute Kritiken.
1924 wird Camilla am „Theater in der Josefstadt“ in Wien engagiert, das zu den Reinhardt Bühnen gehört. Vollkommen konzentriert und leidenschaftlich widmet sie sich ihrem Beruf und lebt dafür, zu lernen und eine gute Schau- spielerin zu sein. Beinahe ermüdend empfindet sie dagegen die Umwerbungen von Hermann Eisner, dem Rechtsreferendar, den sie auf einem Ball kennenlernt. Ernüchternd sagt sie rückblickend über diese Beziehung: „Ich war des Neinsagens müde und wir heirateten schließlich zwei Jahre nachdem wir uns kennengelernt hatten.“ Ihrem Lebensstil folgend feiert das Paar 1927 in Berlin eine gutbürgerliche jüdische Hochzeit. Aber eigentlich will Camilla Spira ihr Leben lang für das Theater leben.

Camilla in jungen Jahren
Im selben Jahr kommt Sohn Peter zur Welt, was sie aber keinesfalls dazu bringt, ihrer Arbeit weni- ger Bedeutung beizumes- sen. Von 1925 an ist sie für zwei Jahre am „Deutschen Theater“ in Berlin tätig, bis sie von 1927 bis 1930 an den Barnowsky Bühnen engagiert wird. Die drei Jahre danach arbeitet sie mit großem Erfolg an der „Volksbühne“. Die doppelte Begabung von schauspielerischem Talent und hoher Musikalität macht ihre Qualität aus und bringt ihr große Po- pularität ein.
Ab November 1930 spielt sie ein Jahr lang die Rößl-Wirtin in Zum Weißen Rößl vom Wolfgangssee und bezieht ein sehr gutes Einkommen. Dieses Stück, welches später auch verfilmt wird, macht sie in ganz Deutschland berühmt. Sie lebt in großem Stil mit Haushälterin und komfortabler Wohnung in Berlin. Die Filmbranche hat schnell Notiz von ihr genommen und so reißt die Serie von Produktionen, in denen sie mitwirkt, bis 1933 nicht ab. Sie spielt in Fritz Langs Das Testament des Doktor Mabuse und 1932 in Morgenrot (Regie Gustav Ucicky) mit.
Camilla Spira verstrickt sich tief in ihre Arbeit, ist diszipliniert und konzentriert. Sie begründet viele Jahre später mit ihrer Begeisterung darüber, in ihrem Beruf ihre Erfüllung gefunden zu haben, den Mangel an persönlichem Interesse am politischen Tagesgeschehen. Sie hat zunächst die Nationalsoziali- sten nicht als gefährlich empfunden. Sie erzählt 1991, daß sie erst davon Notiz genommen habe, als die nationalsozialistische Gesetzgebung ihr 1933 verbietet, öffentlich aufzutreten, weil sie Halbjüdin ist. Erlaubt bleibt ihr noch, vor jüdischem Publikum zu spielen. Die Absurdität des antisemitischen Konzepts der Nationalsozialisten wird deutlich, als ihr einen Tag vor ihrem Berufsverbot zur Uraufführung von Morgenrot und im Beisein der NS-Führungsriege ein Lorbeerkranz mit Schleppe überreicht wird, auf der steht: „Der Darstellerin der Deutschen Frau — Die Ufa.“.
Entrüstet bezeichnet Camilla Spira die Geschwindigkeit, in der diese Ereignisse aufeinander folgen als irrsinnig und unglaubwürdig. Es geht für sie alles viel zu schnell, um die Realität erfassen zu können.
Fünf Jahre lang verharrt sie noch mit ihrer Familie in Berlin, liest gelegentlich vor befreundetem Publikum in kleinem Kreis und zehrt von den Einkünften durch die Rößl-Wirtin. Tochter Susanne kommt 1937 zur Welt. Dann hat Camilla Spira es geschafft, ihren Mann zur Ausreise zu überreden. Mit der Linie Amsterdam fährt die Familie Spira-Eisner nach New York. Dort an- gekommen werden sie sogleich als einwanderungsverdächtige Personen eingesperrt. Es ist der Hilfe einflußreicher jüdischer Emigranten in Amerika zu verdanken, daß das Ehepaar aus dem Gefängnis freikommt. 14 Tage nach ihrer Ankunft in Amerika kehren sie diesem Land wieder den Rücken, weil es ihnen von vornherein nicht gefällt und sie als „Unerwünschte“ behandelt werden. Entgegen allen Ratschlägen und im Gegensatz zu fast allen Exilwegen deutscher Flüchtlinge, reist die Familie Spira-Eisner zurück nach Europa mit Ziel Amsterdam. Hermann Eisner kann als Jurist in den Niederlanden arbeiten und Camilla spielt Kabarett, hält sich mit Privataufführungen finanziell über Wasser und geht mit dem weißen Rößl am Wolfgangssee auf Tournee. Die Zeit des Exils ist endgültig eingeläutet und sollte bis 1947 währen.

1908 geboren und mit sieben Jahren eingeschult, ist Steffie Spira genauso leb haft interessiert an szenischen Darstellungen wie Camilla. Sie liebt es, sich zu verkleiden und genießt das durch den Vater verursachte etwas andere Familienleben. Nie, so sagt sie in einem Interview, sei sie an dem Punkt angelangt, ihre Schwester zu beneiden. Immer habe sie ihren eigenen Weg gefunden, auch, oder gerade weil sie ihre Individualität stets in den Dienst der Allgemeinheit gestellt hat. In Kinderjahren wird dieses Anliegen durch einen politisch links orientierten Onkel, der im Haushalt verkehrt, bei Steffie verwurzelt. Später drückt sich diese Prägung, das eigene Handeln immer in der Verantwortung zur Gesellschaft zu sehen, in der ausschließlichen Ensemblearbeit aus. Sie ist keine Schauspielerin, die mit ihrem Talent hausiert und sich alleine im Rampenlicht stehen sehen will. Sie legt sehr viel Wert darauf, die eigene Arbeit in der Gruppe des Ensembles zu diskutieren und kritisch zu beleuchten.
So, wie Camilla Spira anfänglich versucht, das Malen zu ihrer Profession zu machen, ist es bei Steffie der Tanz, dem ihre frühe Leidenschaft gehört:
Schon als Kind wollte ich nichts als tanzen. Mein Vater sagte: „Schön, aber das Geld für den Tanzunterricht mußt du dir selbst verdienen.“ Bald nachdem ich eingeschult worden war, durfte ich Unterricht in rhythmischer Gymnastik nehmen, dann eine Ballettschule besuchen, und mein Vater verschaffte mir die er sten Engagements. So fuhr ich abends in das Theater in der Königgrätzer Straße. In dem Stück von Bernauer ‚Die wunderlichen Geschichten des Kapellmeisters Kreisler’ hatte ich im ersten Akt zu tun.
Mit 15 Jahren führt Steffie Spiras Weg in eine Tanzschule nach Dresden zu Mary Wigman. Ihr Traum vom Tanzen scheint berufliche Wirklichkeit werden. Doch während eines Aufenthalts mit der Familie in Wien 1924, als Camilla im Theater in der Josefstadt ihre erste Premiere hat, passiert das Unglück: Steffie stürzt beim Laufen über eine Baumwurzel und zieht sich einen Sehnen- und Kapselriß zu. Das Ende der Tanzkarriere stellt sich ein, bevor sie begonnen hat. Da sie es schon als Kind liebte, mit ihrer Schwester Camilla szenische Darstellungen einzuüben, steht für sie fest, nun Schauspielerin zu werden.
Zurück in Berlin spricht sie bei Ilka Grüning und Lucie Höflich vor, die sie aber nicht sofort als Schülerin annehmen wollen und sie noch drei Monate vertrösten. Seinem ungeduldigen Charakter entsprechend meldet Fritz Spira seine Tochter ohne große Überlegungen in der Schauspielschule der Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger an. Von jetzt an muß Steffie Spira auf eigenen Beinen stehen.
„Bis zu diesem Tag war ich für dein Gesicht und überhaupt für dich ver-antwortlich, jetzt schau zu, wie du dein Leben selber gestalten wirst.“
Diese Aussage ihrer Mutter hat Steffie ernst genommen und in die Tat umgesetzt.
„Keine Ermahnungen, keine Vorbilder wurden gegeben. ‚Du selber’ – das war der Auftrag. Ich habe ihn ernst genommen.“
In der Schauspielschule der Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger lernt Steffie Spira Günter Ruschin kennen.

Über diese Begegnung sagt sie: „Bis heute kann ich mir darüber keine Rechenschaft ablegen, warum ich vom ersten Moment an das Gefühl hatte: Das ist der Mensch, der zu mir gehört.“ Günter Ruschin ist engagierter Schauspieler und überzeugter Kommunist. Mit ihm zusammen läßt Steffie Spira sich durch die Genossenschaft zur Schauspielerin ausbilden und erhält 1925 ihr erstes Engagement bei Viktor Barnowsky in Berlin. 1926 tritt sie in die Gewerkschaft der Schauspieler ein. Drei Jahre später spielt sie auf der Volksbühne am Bülowplatz in Shakespeares Was ihr wollt und im selben Jahr in Bertolt Brechts Mann ist Mann.
In Abgrenzung zu bürgerlichen Bühnen gründet sich 1931 aus vielen ar- beitslosen Schauspielerinnen und Schauspielern die „Truppe 31“ um Gustav von Wangenheim herum. Das Kollektiv bringt szenisches Kabarett auf die Bühne und experimentiert mit dem Stück Mausefalle, in dem die vielen Mitwirkenden bestens bekannte Situationen der Arbeitslosigkeit auf der Bühne thematisieren. Das Theater war schon immer ein Mittel für Steffie Spira, etwas zu verändern. Engagiert, beruflich wie privat, weiß sie, daß sie in diesem Ensemble das richtige Medium gefunden hat.
„Diese langweilige Gesellschaft, diese langweilige Welt wollten wir verändern“
Mit 23 Jahren wird Steffie Spira KPD-Mitglied und zieht in die Künstlerkolonie am Laubenheimer Platz in Berlin, wo u.a. Erich Mühsam und Rudolf Leonhard wohnen. Im selben Jahr heiratet sie Günter Ruschin. Der Kreis, in dem sie lebt, ihre Nachbarn, Arbeitskollegen und Freunde sind alle politisch gleich orientiert.
„Links zu sein war zu dieser Zeit in Schauspielerkreisen eine Selbstverständlichkeit. In Parteien organisierte Kollegen aber gab es nur wenige.“
Mit der „Truppe 31“ wird am 04. Februar 1933 Wer ist der Dümmste? am Kleinen Theater unter den Linden aufgeführt. Dieses Stück wird zwei Tage nach dem Reichstagsbrand am 29. Februar 1933 verboten.
Seit dem Reichstagsbrand wird der Terror gegen die Kommunistische Partei immer größer. Steffie Spira ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch aktives Parteimitglied der KPD. In den Nächten kleben die Genossen Spira und Ruschin Partei-Plakate und tarnen sich bei Bedarf als küssendes Liebespaar. Unter ihrem Bett in der Künstlerkolonie liegen zusammengerollte rote Fahnen.
Vorsorglich haben Steffie Spira und Günther Ruschin immer wieder außerhalb ihrer Wohnung übernachtet, aber am 15. März 1933 wird das Paar bei einer Razzia in der Künstlerkolonie verhaftet. Obwohl der Kontakt zu Camilla Spira nicht sehr intensiv ist, profitiert Steffie Spira davon, eine so berühmte Schwester zu haben. Der Polizist, der Steffie Spira abführt, weiß, daß sie die Schwester der berühmten Schauspielerin Camilla Spira ist, die zu dem bereits sehr populär ist. Der Polizist gibt ihr Geleit bei der Verhaftung, führt sie an einer Gruppe SA-Leute vorbei und bewahrt sie so vor der politisch begründeten Verhaftung. Sofort nach diesem Erlebnis kauft sich Steffie Spira in Berlin eine Fahrkarte nach Zürich, setzt sich in den nächsten Zug und verläßt das Land mit nichts als ihrem Paß und einer Tasche in den Händen, ohne zu wissen, was aus ihrem Mann wird. Ihre Wahl fällt auf die Schweiz, weil dieser Fluchtweg nach Absprache mit ihren Genossinnen und Genossen am besten im Rahmen der in- ternationalen Solidarität organisiert ist. An diesem Punkt ihres Lebens, zu Be- ginn der Flucht vor der Naziherrschaft, ist Steffie Spira in ein starkes solidarisches Umfeld gebettet, welches sich aus Genossen, Freunden und Verwandten zusammensetzt.
Der Gedanke, Deutschland zu verlassen, ist ihr nicht neu. Als Halbjüdin und Kommunistin ist sie schon lange darauf vorbereitet, eines Tages durch Flucht eventuell ihr nacktes Leben retten zu müssen. In Zürich weiß Steffie, daß sie zunächst bei einem befreundeten Ehepaar Unterschlupf finden kann.
In ihrer Autobiographie schreibt sie über die Solidarität deutscher Exilanten:
Im März 1933 in Zürich ankommen, die Bahnhofstraße hinuntergehen, eine Te lefonzelle betreten und bei Carl und Grete anrufen, sagen: „Ich bin hier!“ , und als Antwort hören: „Komm, wir erwarten Dich!“ – nur wer in der tiefsten Ungewißheit gelebt hat, wer das Leben nicht mehr allein, sondern bloß mit Hilfe an- derer Menschen bestehen konnte, nur der weiß, was Freundschaft bedeutet. Für immer seien Hubachers bedankt.
Im Mai 1933 öffnen sich die Zellentüren für Günter Ruschin in Moabit. Niemand weiß so recht, warum er wieder gehen kann. Genossen, Eltern und Freunde haben sich bemüht, ihn freizubekommen, da er doch keine zentrale Rolle in der KPD spiele. Am 28. Mai 1933 um 21:00 Uhr fährt Günter Ruschin mit dem Zug nach Zürich. Um 22:00 Uhr steht die SA bei seinen Eltern vor der Tür, um ihn wieder abzuholen. Tatsächlich erweist sich die Freilassung als Irrtum. Der Ehemann Steffie Spiras ist gerade noch durch den noch nicht lückenlos funktionierenden Bewachungsapparat geschlüpft und kann Deutschland 1933 legal verlassen. Das wohlbetuchte Ehepaar Hubacher gewährt den Ruschins sowie anderen Genossinnen und Genossen Logis in ihrer Wohnung in Zürich. Dort werden Theater- und Kabarettstückchen entworfen und ausgear- beitet und man denkt darüber nach, wie es weitergehen kann ohne Einkommen. Zunächst kann bei einer Tournee Adele Sandrocks ausgeholfen werden und gelegentlich kommt ein Lustspiel zur Aufführung. Doch längerfristige Perspektiven bietet die Schweiz nicht. Steffie Spira und Günter Ruschin wandern im Sommer 1933 über den Jura nach Frankreich.
Seit dem Moment, als sowohl Steffie als auch Camilla Spira ihrer Ausbildung nachgehen, driften ihre Wege auseinander. Beide haben Erfolge und entwickeln sich völlig unabhängig voneinander zu namhaften Schauspielerinnen. Steffie als Verfechterin des politisch engagierten Ensembletheaters, Camilla als gefeierte Darstellerin vorwiegend im populären Musikfilm und Operetten-Genre.
Die Spur ihrer Eltern kann nur bedingt verfolgt werden. Lotte Andresen-Spira reist 1933 zu ihrer Tochter Steffie nach Paris, um ihr bei der Geburt des Enkelsohnes Tomas zur Seite zu stehen. Zwischen 1934 und 1937 werden die Eltern geschieden, nachdem Fritz Spira seine Frau davon überzeugte, daß dies in Anbetracht ihrer Mischehe der beste Schritt sei. Lotte Spira arbeitet weiter als Schauspielerin, u.a. als Neben- und Kleindarstellerin im Film. Beide sterben im Jahr 1943, die Mutter in Berlin, der Vater im KZ Ruma (Jugoslawien).
Camilla Spira verbringt die Zeit des Exils in den Niederlanden. Zehn Jahre ist sie durch die Naziherrschaft gezwungen, sich von ihrer Heimat fernzuhalten.
Niederlande
Die Niederlande sind zwischen 1933 und 1939 neben Wien, Prag, Zürich und Paris ein wichtiges Zentrum der Emigration. Dorthin strömen viele Flüchtlinge aus Deutschland. Politisch zeichnen sich die Niederlande zu dem Zeitpunkt durch eine mehr als hundert Jahre währende Neutralitätspolitik aus. Juden sind seit 1796 gleichberechtigt und sichtbaren Antisemitismus gibt es kaum. Die Kirchen haben großen, gesellschaftspolitischen Einfluß und bestehen tolerant nebeneinander.
Der größte Handelspartner Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre ist Deutschland. Nach dem 1. Weltkrieg sind von den Niederlanden 140 Mio. HFL an die deutsche Industrie als Kredit gezahlt worden, und Investitionen von Firmen wie Philips oder UniLever unterstützen die deutsche Wirtschaft in ihrer Entwicklung. Das führt zu sehr engen Handelsbeziehungen, die in beiderseiti- gem Interesse bestehen. Noch 1933 wird die Ernennung Hitlers zum Reichs- kanzler zunächst positiv aufgenommen und politisch genutzt, da er die strikte Vorgehensweise gegen die „Welle des Bolschewismus“ ankündigt. Der Nationalsozialismus wird von den handeltreibenden Niederländern in seiner Gefähr- lichkeit unterschätzt.
1933/34 verfestigt sich die niederländische Politik der Nicht-Intervention im Hinblick auf Deutschland. Die Hoffnung macht sich breit, daß, wer sich still verhalte, nicht mit Aggressionen zu rechnen habe. Die Niederlande hoffen darauf, Deutschland mit den Rohstoffen aus ihren Kolonien zufrieden zu stellen und ihre Unabhängigkeit in dieser Weise erkaufen zu können. Dieser Plan scheitert, weil die Weltwirtschaftskrise, die die Kaufkraft aller Länder mindert, auch Deutschland erfaßt. Sie bedeutet vor allem die „Beschneidung des außen- politischen Spielraums der niederländischen Regierungen“, weil die aus den Kolonien angebotene Ware von Deutschland nicht mehr angemessen bezahlt werden kann. Zusätzlich steht der Millionenkredit aus dem ersten Weltkrieg noch offen. Die Gefahr steigt, statt mit einer Bezahlung mit einer Besetzung durch den Aggressor Deutschland rechnen zu müssen.
Die Außenpolitik entfernte sich immer mehr von einer Selbständigkeitspolitik und ist ab 1935 eher als eine Non-Interventionspolitik zu bezeichnen. Als kleiner Nachbarstaat des Dritten Reiches gerieten die Niederlande immer mehr unter den wirtschaftlichen Einfluß dieses Staates.
Die Niederlande sind für Emigranten aus dem Dritten Reich durch ihre geographische Nähe und die günstigen Einreisebestimmungen ein sehr beliebtes Ziel. Die Sprachbarrieren sind wesentlich geringer als in romanischen Ländern. Die Anbindung nach Übersee ist vorhanden, um in die USA oder nach Lateinamerika zu gelangen. Ebenfalls wäre eine schnelle Rückkehr nach Hause möglich, sobald wieder politisch akzeptable Zustände in Deutschland herrschen.
Zwischen 1933 und 1940 überschreiten Zehntausende Flüchtlinge die deutsche Grenze zu den Niederlanden. Es sind Kommunisten, Sozialisten, Künstler, Wissenschaftler und Juden oder sie gehören einer weiteren Bevölkerungsgruppe an, der die NS-Herrschaft es unmöglich macht, im Deutschen Reich weiter- zuleben. Hervorzuheben ist die internationale Verbundenheit der linken Partei- en, die tatsächlich fast weltweit funktioniert.
„Die KPD-Flüchtlinge hielten sich meist illegal im Land auf, organisierten sich in kleinen Zellen und wurden von ihren holländischen Parteigenossen intensiv unterstützt.“
Repressalien innerhalb der Niederlande gegenüber den deutschen Flücht- lingen beginnen erst, als der von Deutschland ausgehende politische Druck auf den kleinen Nachbarn größer wird. Die Unterstützung der Emigranten durch die niederländische Regierung darf zu dem Zeitpunkt nicht zu deutlich werden, da dies wiederum als ein Ausdruck der Feindschaft gegenüber dem Deutschen Reich interpretiert werden könnte.
Deutschsprachiges Kulturleben in den Niederlanden
Das allgemeine, kulturelle Leben in den Niederlanden ist in den dreißiger Jahren ähnlich organisiert wie in Deutschland heute. Alle Theater werden hin- sichtlich des Hauses und des ständigen Ensembles von den jeweiligen Kommunen mitfinanziert. Es sind Stadttheater, die an Privatunternehmen verpachtet und von diesen geführt werden. Deutsche Tourneeensembles führen Opern, Operetten und Theaterstücke auf. Dadurch, daß nur die ständigen Schauspieler vor Ort von den Kommunen getragen werden, ist es von erheblicher Wichtig- keit, als fahrendes Ensemble Zuschauerzahlen zu garantieren. Anders ist kein Auftritt zu erhandeln. Zwar werden für längere Zeit von den niederländischen Theatern deutschsprachige Stücke mit ins Programm genommen, aber die deut- schen Immigranten als Publikumsklientel sind trotz Theaterinteresses keine Garanten für volle Häuser auf lange Sicht. Die Folgen sind fahrende Ensembles,die zwar finanziell sehr schlecht gestellt sind, ihren Angehörigen aber immerhin Beschäftigung bieten.
Die Emigranten-Kabaretts „Ping Pong“ und die „Pfeffermühle“ um Erika Mann formieren sich. Im Juli 1933 erlassen die Niederlande das Verbot jeglicher politischer Betätigung deutscher Emigranten. Zuwiderhandlungen werden mit Abschiebung bestraft. Das Kabarett „Pfeffermühle“ wird für unerwünscht erklärt und so wird vielen engagierten Künstlern der Unterhalt und die Existenz entzogen.
Seit 1934 existieren in den Niederlanden Aufnahmebeschränkungen für Verfolgte aus Deutschland. Im Frühjahr 1938 schließt das Land seine Grenzen. Die Familie Eisner-Spira erhält, gerade aus den USA kommend, noch eine Einreiseerlaubnis in die Niederlande. Hermann Eisner arbeitet als Jurist und Sohn Peter geht zur Schule. Als im Mai 1940 deutsche Truppen Richtung Rotterdam ziehen, um den Hafen zu besetzen, versuchen die Eisner-Spiras 1940 erneut, das Land per Schiff zu verlassen. Rotterdam steht aber schon in Flammen, so daß sie dort nicht einmal den Zug zu verlassen können. Er rollt genauso wieder zurück nach Amsterdam, wie er gekommen ist.
Durch die deutsche Besetzung der Niederlande sind seit Oktober 1940 Kunstschaffende verpflichtet, einen Abstammungsnachweis vorzulegen. Camilla Spira tritt im Kulturbund in der „Hollandsche Schowburg“ in Molnars Spiel im Schloß und in Die Fee auf. Darüber hinaus betätigt sie sich am Kabarett des jüdischen Kulturbundes, welches 1940 in Amsterdam von Werner Le- vie für und von Emigrantinnen und Emigranten gegründet wird. Sie spielt mit Max Ehrlich, Kurt Gerron und Willy Rosen Szenen von Brecht und Tucholsky. Der Kulturbund existiert bis zu den Massendeportationen 1943.
Im Mai 1941 sind alle kulturellen Bereiche gleichgeschaltet und werden zensiert. Seitdem die Besatzungsmacht 1941 zentrale Kulturkammern eingeführt hat, können jüdische Künstler nur noch vor jüdischem Publikum in einem abgetrennten Viertel in Amsterdam auftreten.
„In diesem jüdischen kulturellen Ghetto wurden keine Unterschiede mehr zwischen Deutschen und Niederländern gemacht.“
Die deutsche Besetzung der Niederlande führt zur Verhaftung Hermann Eisners und Camilla Spiras. Im Internierungslager Westerbork gibt Camilla mindestens eine Vorstellung der Rößl-Wirtin, weil der Lagerkommandant es ihr auferlegt. Camilla Spira gehört zum ersten Programm der „Gruppe Bühne“.
Die „Gruppe Bühne“ ist ein aus den Insassen des Lagers Westerbork zusammengestellte Theatergruppe, die im Lager für kulturelle Unterhaltung sorgen muß. Im Oktober 1943 wird Camilla Spira mit wenigen anderen freigelassen. Stark beteiligt daran ist ihre Mutter Lotte Andresen-Spira, die in Deutschland glaubhaft beteuert, daß der Jude Fritz Spira nicht Camillas Vater sei. Dank die ser Behauptung kann Camilla in die Wohnung nach Amsterdam zurückkehren.
Für die Jahre 1943 bis 1945 gibt es keine Informationen über die Familie von Camilla Spira. Vermutlich ist die Familie in den Niederlanden untergetaucht. Nach Kriegsende dauert es zwei Jahre, bis das Ehepaar nach Berlin zurückkehrt. In den Trümmern der alten Hauptstadt beginnt Camilla Spira 1947 am „Theater am Schiffbauer Damm“, dem späteren „Berliner Ensemble“, zu arbeiten. Dort spielt sie in Der zerbrochenen Krug mit. 1948 ist sie sogar an mehreren Bühnen West-Berlins tätig. Camilla Spira kann wie wenige andere an ihre Popularität vor dem Nationalsozialismus anschließen. Die Filmschaffenden nehmen ebenfalls bald wieder Notiz von ihr. Sie dreht mit Curd Jürgens 1955 Des Teufels General und stellt 1959 die Frau des Staatsanwalts Schramm in Rosen für den Staatsanwalt dar. Sie spielt Theater im Osten und Westen der Stadt. Sie entscheidet sich aber, mit ihrem Mann im Westteil Berlins zu leben.
1952 verliebt sie sich in den Kameramann Franz Hofer und lebt fortan teilweise mit ihm als Geliebten in der Nähe Münchens, teilweise bei ihrer Familie in Berlin. Zu einer Scheidung von Hermann Eisner kommt es nicht. Nachdem beide Männer im Abstand von drei Jahren sterben, will Camilla Spira auch ihrem Leben ein Ende setzen, jedoch findet Franz Hofers Bruder sie gerade noch rechtzeitig und kann sie vor der Wirkung der tödlichen Dosis Schlaftabletten retten.
Frankreich
Die durch die Weltwirtschaftskrise hervorgerufene hohe Arbeitslosigkeit in Frankreich ist eine der Ursachen dafür, daß weder die Bevölkerung noch die französischen Behörden dem Emigrantenstrom aus Deutschland ab 1933 freundlich gesinnt sind. Frankreich, das Land, das laut Heinrich Mann dem Kontinent die Menschenrechte geschenkt hat, zeigt wenig Interesse am politi- schen Geschehen in Deutschland. Das stete Anwachsen des Flüchtlingsstroms zieht schnell eine sich verschärfende Anwendung der bestehenden Asylgesetze nach sich. Unter anderem wird plötzlich größerer Wert darauf gelegt, zwischen verschiedenen, für die Einreise nach Frankreich notwendigen Papiere genau zu unterscheiden und die betreffenden Personen zu überprüfen. Es gibt die carte d’identité, die dem Personalausweis gleicht, die Aufenthalts- genehmigung, welche bei Verlassen des Landes, z. B. um Verwandte nachzu- holen, die Wiedereinreise sicherstellt, und das Ausweisungspapier. Das Ausweisungspapier ist für die Flüchtlinge aus Deutschland von fataler Bedeu- tung, weil es das legale Betreten Frankreichs endgültig verbietet. Es ist nicht anzunehmen, daß Steffie Spira und ihr Ehemann Günther Ruschin in Besitz irgendeines der hier erwähnten Schriftstücke waren. Die Grenze zwischen der Schweiz und Frankreich überschreiten sie zu Fuß, der Zöllner nimmt kaum Notiz von ihnen.
Das Ziel ist Paris. Scheinbar ohne größere Schwierigkeiten nimmt die schwangere Steffie diesen Gewaltmarsch auf sich und erreicht, zum Teil auf Wander- und Waldwegen, die französische Hauptstadt. Im November bringt Steffie Spira ihren Sohn Tomas zur Welt. Um ihr bei der Geburt beizustehen, reist Lotte Andresen-Spira, Steffies Mutter, aus Deutschland an und bringt et- was Geld für die junge Familie mit.
Die französische Regierung ist bemüht ein neutrales Verhalten gegenüber den Flüchtlingen an den Tag zu legen. Dies gelingt aber nur bedingt. Die Ausstellung einer carte d’identité zum Beispiel ist der Willkür der Behörden unterworfen. Kaum ein Exilant kann den dafür erforderlichen Nachweis erbringen. Dies liegt daran, daß die Heimat oft Hals über Kopf verlassen werden muß und selten vorher die Möglichkeit besteht, die nötigen Papiere zu beantragen. Eine politische Unterstützung der antifaschistisch engagierten Exilanten durch französische Behörden oder Organisationen bleibt nahezu gänzlich aus. Das brisante Thema des Widerstands gegen den Faschismus ist von offizieller Seite mit einem Tabu belegt, um Ruhe in der Außenpolitik zu erhalten.
Die deutschen Einreisewilligen sind schlecht über die notwendigen Formalitäten informiert, da das primäre Ziel die schnelle Ausreise aus Deutschland ist und nicht die legale Einreise nach Frankreich. Die Emigranten vermeiden es, mit französischen Behörden in Kontakt zu treten, denn nur die wenigsten fin- den sich im französischen Behördendschungel der dreißiger Jahre zurecht. Viele sind der Sprache nicht mächtig genug, um sich zuversichtlich auf den Gang durch die Ämter begeben zu können. Eindringlich beschreibt Steffie Spira in ihren Memoiren die prekäre Situation der Exilanten:
Nur wer es durchmachen mußte, ein „Objekt“ zu sein, abhängig von der Freundlichkeit der Behörden, wer bald zu dieser, bald zu jener Stelle laufen mußte, um am Ende doch die so notwendigen Papiere zu bekommen, nur der
weiß, was Ungewißheit bedeutet.
Anlaß für diese Sätze in ihren Memoiren ist die Ausbürgerung, die 1936 gegen Steffie Spira und ihren Mann verhängt worden ist.
Im Oktober 1934 wird die Debatte um das Ausländerrecht in Frankreich angeheizt, als der Außenminister Barthou und der jugoslawische König Alexander I. von einem jugoslawischen Ustascha-Faschisten erschossen werden. Als Folge dieses Attentats erhalten Exilanten allgemeines Arbeitsverbot. Im kulturellen Bereich ist das Verbot weniger von Belang, da die Sprachbarrieren viel zu groß sind, als daß Exilanten in nennenswertem Umfang auf dem französischen Arbeitsmarkt konkurrieren zu können.
Paris ist zu diesem Zeitpunkt zu einem Sammelbecken kreativ arbeitender Deutscher geworden. Viele Künstler und Künstlerinnen haben sich, begünstigt durch verwandtschaftliche Verhältnisse oder kollegiale Kontakte, dorthin ori- entiert. Man kennt sich untereinander, und so werden vor allem persönliche Beziehungen zu bereits emigrierten Menschen genutzt, um aus Deutschland he- rauszukommen. Unterstützung aller Art, von der Organisation der Unterkünfte bis hin zur Zusammenarbeit mit dem Ziel, eigenes kulturelles Leben im Aus- land zu gestalten, ist für den Großteil der aus Deutschland geflüchteten Künstlerinnen und Künstler eine ausgesprochen große Hilfe.
Seit April 1935 gibt es jedoch eine „Quotenregelung“ in Frankreich, die vorschreibt, daß bei künstlerischen Produktionen 50 % des Ensembles aus französischen Staatsbürgern bestehen müssen.
Vom 21. bis 25. Juni 1935 findet auf dem „Ersten Internationalen Schrift- stellerkongreß zur Verteidigung der Kultur“ eine Solidaritätskundgebung statt. Die französischen Intellektuellen bieten eine Plattform, sich mit den vom NS-Regime verfolgten Kulturträgern aus Deutschland auszutauschen. Weitreichende Folgen hat dieses Forum aber nicht. Zu stark sind die Einschränkungen von politischer Seite im Kulturbereich.
Seit 1938 werden in Frankreich die Exilanten als Sicherheitsrisiko betrachtet. Politischen Flüchtlingen werden die Rechte entzogen und im August 1939 beginnen die ersten Verhaftungen links engagierter Deutscher, die späterin Internierungslager gebracht werden.
Das Ehepaar Spira-Ruschin wird am 1. September 1939 verhaftet. Zur Familie gehört der kleine Sohn Tomas, der in Frankreich geboren wurde. Zum Zeitpunkt der Verhaftung seiner Eltern befindet er sich mit anderen Kindern auf dem Land. Viele für Kinder eingerichtete Institutionen werden wegen des drohenden Kriegsausbruchs aus den Großstädten weg in ländliche Gebiete verlegt. Steffie Spira kommt ins Gefängnis La Roquette und wird von dort aus ins Frauenlager Riencros bei Mende transportiert. In dieser Zeit hat Steffie Spira ununterbrochen Kontakt zu Genossinnen, und der Zusammenhalt der Partei ist sehr stark. Seit sie Deutschland verlassen hat, verwendet sie ununterbrochen Energie darauf, sich Arbeitsmöglichkeiten im schauspielerischen Bereich zu schaffen. Darüber hinaus bemüht sie sich, anderen Genossinnen und Genossen zu helfen, Kontakte zu erhalten und im Widerstand zu arbeiten. Dadurch entsteht der Eindruck, sie habe nie wirklich in Not, in einem Überlebenskampf gesteckt. Sicher sind Angst und Unruhe die ständigen Begleiter der Familie, aber niemals geht der Antrieb verloren, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, ganz gleich, wie schwierig die Lebenssituation auch ist. Die Unterstützung ehemaliger Arbeitskollegen oder Parteigenossen hilft ihr an vielen Stationen ihres lan- gen Fluchtweges.
Die Situation der Künstlerinnen und Künstler in Frankreich
Steffie Spira und ihr Mann Günter Ruschin haben das Glück, durch parteiinterne Kontakte in ein Paris zu kommen, in dem schon seit längerer Zeit eine Gruppe deutscher Künstler lebt. Man unterstützt sich gegenseitig, Jobs werden vermittelt, und die Idee einer deutschsprachigen Bühne wird innerhalb dieser Gemeinschaft verschiedenster Arbeitsuchender entwickelt. „Am Anfang war es sehr schwierig, sich in Paris zurechtzufinden.“ Auf Initiative Rudolph Leonhards wird der Schutzverband deutscher Schriftsteller (SDS) im Exil gegründet. Der Schriftsteller Rudolph Leonhard lebt schon seit 1927 in Frankreich. Ehrenpräsident des SDS wird Heinrich Mann, weitere Mitglieder sind Anna Seghers, Egon Erwin Kisch, Recha Rothschild, Joseph Roth, Hermann Kesten, Max Schroeder, Theo Balk, Bodo Uhse, Kurt Stern, Arthur Koestler, Gustav Regler, Alfred Kantorowicz und viele andere. In einem Café in Paris werden montags abends Veranstaltungen unterschiedlicher Art organisiert. Steffie Spira beteiligt sich an diesen Abenden, liest aus unveröffentlichten Manuskripten von Schriftstellern oder rezitiert. Diese Beschäftigung erleichtert die Phase des Einlebens in Paris, weil Steffie Spira bekannte Gesichter an diesen Abenden wiedersehen und neue Kontakte knüpfen kann.
Es bestand ein guter Zusammenhalt zwischen Genossen und Freunden. Wir hatten enge Verbindungen miteinander und konnten schnell etwas auf die Beine bringen. Hauptsächlich Leonhard und Regler stellten Kontakte zu französischen Schriftstellern her.
So eine Vorgehensweise ist notwendig, um einerseits Perspektiven zu erschließen, die den Zusammenhalt der Gruppe stärken, andererseits um Einnahmequellen für den Lebensunterhalt zu schaffen. Unterstützung seitens des Gastlandes gibt es nicht. Wollte ein Schauspieler oder eine Schauspielerin im erlernten Beruf arbeiten, mußte die Plattform dafür selbst geschaffen werden.
Als geschlossenes Ensemble versucht Gustav von Wangenheims Truppe 31 im Frühjahr 1933 in Paris Fuß zu fassen. Zum Beispiel findet im Juli 1933 eine Lesung von Friedrich Wolfs Professor Mamlock statt, da eine Aufführung sich nicht verwirklichen läßt. Die Gruppe muß sich im Sommer 1933 wegen materieller Schwierigkeiten und politischer Repressionen gegen in Deutschland verbliebene Angehörige auflösen. Die meisten Mitglieder reisen nach Moskau. Die in Paris Bleibenden gründen um Steffie Spira herum 1934 die Kabarettgruppe „Die Laterne“.
Auch wir Schauspieler – anfangs nur wenige, dann etwa 25 an der Zahl- organisierten uns. Zuerst nannten wir uns Gruppe deutscher Schauspieler. Im Frühjahr 1934 gründeten wir das Kabarett Die Laterne, das in der Rue de Seine auftrat, im Saal des Monsieur Duncan, eines Bruders von Isadora Duncan.
„Die Laterne“ hat es als einzige Kleinkunstgruppe kontinuierlich von 1934 bis 1938 geschafft, als konstantes Ensemble aufzutreten. Es macht eindeutig politisches Kabarett. Darüber hinaus gelingt eine Uraufführung Brechts: Die Gewehre der Frau Carrar, unter der Regie Slatan Dudows. Steffie Spira spielt Frau Perez. Es muß als großer Erfolg gewertet werden, daß überhaupt einmal in Frankreich ein deutsches Theaterstück zur Aufführung gebracht werden konnte. Es folgen Szenen aus Brechts Furcht und Elend des Dritten Reiches unter dem Titel 99%. Diese Phase, in welcher immerhin allen beteiligten Künstlern und Künstlerinnen ein Einkommen durch eigene Arbeit und eine Perspektive für die Zukunft beschieden ist, bleibt durch die politischen Gege- benheiten nur von kurzer Dauer. Keiner deutschen Schauspielerin gelingt es, auf einer französischen Bühne wirklich Fuß zu fassen. Das Kabarett ist und bleibt die einzige Bühne, auf der deutsche Exilanten aus der Schauspielszene längerfristig arbeiten können. „Die Laterne“ bietet 60-80 Sitzplätze, so daß durch Kollektivarbeit tatsächlich ein wenig Einkommen erwirtschaftet werden kann. Stücke von Brecht und Arnold Zweig werden auf die Bühne gebracht, und endlich ist eine Möglichkeit geschaffen, wieder schauspielerisch zu arbeiten. Die Texte werden von Henryk Kreisch, Erich Berg und George Raimund verfaßt oder vom Kollektiv erarbeitet. Die Musik schreibt Jo Cosma, das Bühnenbild übernimmt Heinz Lohmar, der in Paris viele Kontakte knüpft und sich beinahe sogar an der Weltausstellung 1937 beteiligt hätte. Dies scheitert an der Intervention der deutschen Botschaft in Frankreich. Das Publikum setzt sich vornehmlich aus deutschen Emigranten zusammen und aus Mitgliedern der deutschen Botschaft – eine brisante Mischung.
Mit Hilfe dieser Aktionen und Beschäftigungen findet sich die Familie Spira-Ruschin mehr oder weniger in ein „normales“ Leben ein. Als hauptsächliche Einnahmequelle kann das Projekt „die Laterne“ zwar nicht betrachtet werden, jedoch vermittelt es für kurze Zeit dem Ehepaar die Befriedigung, sich selbst eine Art Lebensgrundlage geschaffen zu haben. Darüber hinaus sind die mei- sten emigrierten Künstler gezwungen, Gelegenheitsjobs aller Art anzunehmen, um überhaupt in die Nähe eines Existenzminimums zu gelangen. Durch die näherrückende Gefahr des Krieges gegen Deutschland werden die Lebensverhältnisse der in Paris lebenden Deutschen immer komplizierter. Das kollektive Leben kann zwar relativ „normal“ gestaltet werden, jedoch ist weder die Dauer des Aufenthalts, noch die persönliche Sicherheit gewährleistet.
Weitere Rollen Steffie Spiras bis zu ihrer Verhaftung im September 1939 sind zum Beispiel: Die Frau in Der Spitzel, die Haushälterin in Rechtsfindung, die Köchin in Das Kreidekreuz. In einer Dramatisierung von Joseph Roths Hiob wirkt sie im Theater „Pigalle“ am 03.07.1939 mit.
In den letzten Wochen des Augusts 1939 werden in Frankreich die ersten Kommunisten verhaftet. Die außenpolitische Situation hat sich so zugespitzt, daß Frankreich sich vor Spionage schützen muß, kommunistisch orientierte Ausländer in Gewahrsam nimmt und später in Internierungslagern sammelt. Am 03.09.1939 erklärt Frankreich Deutschland den Krieg. Der Hitler-Stalin- Pakt wird am 23.09.39 unterzeichnet. Alle sich in Frankreich aufhaltenden deutschstämmigen Männer werden von jetzt an in Lager gebracht. Ab Mai1940 werden auch Frauen in Frankreich interniert. Das Waffenstillstandsabkommen zwischen Deutschland und Frankreich wird am 22.06.1940 geschlos- sen. Kurz darauf folgt die Besetzung des nördlichen Teils Frankreichs durch deutsche Truppen. Im unbesetzten Teil gründet Marschall Philippe Petain 1940-1944 ein autoritäres Regierungssystem mit Sitz in Vichy, das mit dem nationalsozialistischen Deutschland zusammenarbeitet. General Charles de Gaulle bildet 1940 eine Exilregierung in London, die den Krieg gegen Deutschland fortsetzt.
Zwischen dem besetzten und dem unbesetzten Teil Frankreichs wird am 27. September 1940 eine Demarkationslinie gezogen. Die Flüchtlinge im okkupierten Frankreich sind nun der Gestapo ausgeliefert. Die Juden werden zu Tausenden in Lager gebracht, von wo sie später in osteuropäische Konzentra- tionslager deportiert werden. Die Vichy-Regierung auf der anderen Seite dieser Linie faßt die Nichtfranzosen ebenfalls in Lagern zusammen, so daß es den Verfolgten hier ähnlich ergeht. 1942 besetzen die deutschen Truppen ganz Frankreich. Aus französischen Internierungslagern werden Deportationslager. Allein aus Gurs werden mehr als 4000 Juden über Drancy nach Auschwitz deportiert.
Bei den Internierungen der sich in Frankreich aufhaltenden Exilanten wird von den französischen Behörden 1939 nach „Berechtigung“ des Aufenthalts sortiert. In die Sammellager kommen Nichtfranzosen mit carte d’identité. In die Gefängnisse kommen die Menschen, denen der Aufenthalt verweigert wur- de und Straflager werden für Menschen mit Ausweisungsbefehl errichtet. Der Grund für die Verhaftung des Ehepaares Spira-Ruschin ist seine Aktivität in der KPD.
Aus den Sammellagern, die zunächst noch keine lebensbedrohliche Gefahr bedeuten, werden diejenigen Männer wieder entlassen, die fronttauglich sind. Die Entlassung kann forciert werden, indem zum Beispiel Verbindungen zu französischen hochgestellten Personen belegt werden, oder eine Ehe mit französischen Staatsbürgern nachweisbar ist. Ebenfalls sehr schnell dürfen die Menschen gehen, die versichern, Frankreich auf dem schnellsten Weg den Rücken zuzukehren. Nach langer Trennung von Mutter und Kind wird Tomas Spira-Ruschin 1941 wieder seiner Mutter zugeführt, die aus dem Lager Le Rieucros Anfang des Jahres entlassen wird mit der Auflage, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Auch Günter Ruschin, der einige Zeit im La ger Le Vernet verbracht hat, kommt frei, und es ist möglich, Ausreisevisa zu organisieren, so daß die Familie offiziell nach Lissabon zu reisen vermag.
Der erste Reiseversuch nach Übersee allerdings scheitert, weil alle Visaanträge von den USA 1941 zurückgestellt werden, mit dem Vermerk: „Kommunisten unerwünscht“ Unsere Nervosität steigerte sich, als sich herausstellte, daß unsere Visa für die USA zwar angewiesen waren, das amerikanische Konsulat in Marseille sie uns aber noch immer nicht aushändigen durfte. Es war fünf Minuten vor zwölf, hatte doch SS-Standartenführer Kund uns im Lager Rieucros und den Männern im Lager Le Vernet schonungslos angekündigt, daß alle jene nach Auschwitz deportiert werden würden, die Frankreich bis zum Oktober 1941 nicht verlassen hätten. Ende August teilte uns das USA-Konsulat mit, daß alle Visaanträge „zurückgestellt“ worden seien. Da sprang der unvergessene, von allen Emigranten hochgeschätzte Gilberto Bosques in die Bresche, der mexikanische Konsul in Marseille. Wir alle, denen die Auslieferung nach Deutschland drohte, bekamen Visa für Mexiko. Er sei bedankt!
Jedoch reicht ein Visum für Mexiko alleine nicht aus, denn auf dem Weg dorthin werden die Länder Spanien, Portugal, die Dominikanische Republik und Kuba durchreist, und man braucht zumindest Transitvisa und zusätzlich auch noch Geld für die Fahrt. Auch in dieser Situation sind es wieder alte Parteifreunde und Bekannte, die weiterhelfen. Sieben Wochen später kann die Reise auf der Serpa Pinto ab Lissabon angetreten werden. Steffie Spira entbindet während der Reise von Paris nach Lissabon auf dem Bahnhof von Madrid 1941 von einer kleinen Tochter. Die Strapazen der Hochschwangeren lösen eine vorzeitige Geburt im achten Monat aus. Das Kind hat keine Überlebenschance. Steffie nimmt das Baby zwar mit ins Hotel in Madrid, wo sich die Familie Ruschin bei jüdischen Besitzern eingemietet hat, es stirbt aber nach zwei Tagen.
Von Madrid aus geht die Reise weiter über Lissabon nach Mexiko. Dort ist das Leben zwar anders als in Europa, aber weitaus angstfreier. Die Familie bezieht eine Wohnung in Mexiko Stadt. Ihren Lebensunterhalt erwirtschaften sie durch Gelegenheitsjobs. Steffie arbeitet als Hausangestellte bei einem ursprünglich aus Deutschland stammenden Ehepaar. Darüber hinaus gibt es für sie und Günther Ruschin auch immer ein paar Betätigungsfelder im Heinrich Heine Club. Hier arbeiten viele Emigranten aus Deutschland wieder zusammen. Namen wie Anna Seghers und Egon Erwin Kisch sind zu nennen. Gelegentlich wird von Bekannten und Freunden irgend etwas vermittelt, was Einkünfte verspricht. Auf diese Art und Weise hält sich die Familie Spira-Ruschin über Wasser und kann ein einigermaßen angenehmes, gleichwohl bescheidenes Leben führen, bis sie 1947 wieder nach Deutschland zurückkehrt.
Diese Rückkehr ist klar an das Ziel Berlin ge- bunden, wo Steffie Spira sehr bald an der „Volks- bühne“ in der Kastanienallee ein Engagement erhält. Das „Theater am Schiffbauer Damm“ macht ihr ebenfalls zu Beginn 1948 ein attraktives Angebot. Ihre schauspielerische Tätigkeit läßt sich wie die ihrer Schwester ebenfalls auf der Bühne ohne größeren Bruch fortsetzen, was damit zusammenhängt, daß Steffie Spira Parteimitglied, Widerstandskämpferin und gut ausgebildete Schauspielerin ist. Für sie und ihre Familie ist es selbstverständlich, in der sowjetisch besetzten Zone zu leben. Sie spielt 1949 die Kommissarin in Der Moskauer Charakter, 1952 Polina in Die Feinde, 1953 die Heiratsvermittlerin in Gogols Die Heirat, 1953 Martha Lühring in Der Teufelskreis – die lange Reihe ihrer Rollen ließe sich fortsetzen. In den siebziger Jahren kreiert sie eigene Abende mit den Titeln Vorstellungen über Vorstellungen und Frauen an der „Volksbühne am Luxemburgplatz“. Sie gilt als die erfahrenste und etablierteste Schauspielerin Ost-Berlins.
Steffie Spira und ihre Schwester Camilla

1991, 84-jährig, läßt sich Camilla Spira zusammen mit ihrer Schwester auf der Bühne in Baden-Baden feiern, trägt Heine-Gedichte vor und gestaltet einen Auftritt mit ihrer Schwester. In der Fernsehproduktion des Südwestfunks über die beiden Schwestern wird deutlich, wie gegensätzlich und vergleichsweise betagter Camilla ihrer Schwester Steffie gegenüber ist.
Noch immer adrett geschminkt und sich während des Interviews sehr telegen in Szene setzend, gibt sie offen zu, daß sie sich an viele Dinge aus ihrer Lebensgeschichte nicht mehr erinnert. Sie bezeichnet sich und Steffie als sehr unterschiedlich und äußert ihre Überzeugung, mit dem Medium Theater niemals politisch etwas verändern zu können. Sie hat ihre Arbeit als Auftrag angesehen, die der Unterhaltung dient, und nicht ideologischen Zielen. Am 28. August 1997 stirbt mit Camilla Spira eine Zeitzeugin des Jahrhunderts.
Ganz im Gegensatz dazu steht Steffie Spira, die immer etwas bewirken will mit ihrer Arbeit. Sie bezeichnet ihre Schwester als
„Ton in des Töpfers Hand – mit wem du lebst, dessen Sinn und Inhalt erlebst du auch. Selbständig bist du nie gewesen, heute fängst du an, langsam es zu sein.“
Als hochbetagte Frau, Kommunistin und anerkannte Schauspielerin der DDR steigt sie am 09. November 1989 auf dem Alexanderplatz aufs Podest und hält eine Rede vor über 500 000 Zuhörern. Bis ins hohe Alter weiß sie der Gesellschaft etwas mitzuteilen, was dazu beitragen könnte, dem harmonischen Zusammenleben ein Stück näherzukommen. Auch hier stellt sie sich als Indivi- duum wieder zurück und verleiht der Gesellschaft eine Stimme, tritt für die Bewegung zur demokratischen Erneuerung der DDR ein. Der Elan und die Stimme dieser Frau versiegen am 10. Mai 1995. Nachklang und Wirkung findet die Stimme bis heute.
Literatur
Dittrich, Kathinka/Würzner, Hans (Hrsg.): Die Niederlande und das deutsche Exil 1933-1945. Königstein 1982.
Hilchenbach, Maria: Kino im Exil. München 1982.
Mittag, Gabriele: Die Sünde und Schande der Christenheit hat ihren Kulminationspunkt erreicht.
O. Ort u. Jahr.
Raabe, Katharina: Deutsche Schwestern. Reinbek 1998.
Spira-Ruschin, Steffie: Trab der Schaukelpferde. Freiburg 1990.
Trapp, Frithjof/Mittenzwei, Werner/Rischbieter, Henning/Schneider, Hansjörg (Hrsg.): Handbuch des deutschsprachigen Exiltheaters 1933-1945. 2 Bde. Bd. 1: Verfolgung und Exil deutschspra- chiger Theaterkünstler. München 1999.
Villard. Claudia: Exiltheater in Frankreich. In: Trapp, Frithjof/Mittenzwei, Werner/Rischbieter, Henning/Schneider, Hansjörg (Hrsg.): Handbuch des deutschsprachigen Exiltheaters 1933- 1945. 2 Bde. München 1999.
http://kultur-netz.de/kueko/bewohner/spira.htm
Fernsehdokumentation
„So wie es ist, bleibt es nicht“ – Die Geschichte von Camilla und Steffie Spira. Fernsehdokumen- tation von Marlet Schaake und Horst Cramer. WDR/SWF 1991.
Schaake/Cramer: „So wie es ist bleibt es nicht“. Fernsehdokumentation 1991.
Filmographie Camilla Spira.
– Freies Volk, R: Martin Berger, 1925
– Der Stolz der Kompagnie (Alternativtitel: Die Perle des Regiments), R: Georg Jacoby, 1926
– Wir sind vom k.u.k. Infanterie-Regiment, R: Richard Oswald, 1926
– Die lustigen Musikanten, R: Max Obal, 1930
– Die Faschingsfee, R: Hans Steinhoff, 1930/31
– Mein Leopold, R: Hans Steinhoff, 1931
– Skandal in der Parkstrasse, R: Franz Wenzler, 1931/32
– Die elf Schill’schen Offiziere, R: Rudolf Meinert , 1932
– Gehetzte Menschen, R: Friedrich Fehér, 1932
– Grün ist die Heide, R: Hans Berendt, 1932
– Ja, treu ist die Soldatenliebe, R: Georg Jacoby, James Bauer, 1932
– Das Testament des Dr. Mabuse, R: Fritz Lang, 1932/33
– Morgenrot, R: Gustav Ucicky, 1932/33
– Der Judas von Tirol, R: Franz Osten, 1933
– Die Nacht im Forsthaus (Alternativtitel: Der Fall Roberts), R: Erich Engels, 1933
– Sprung in den Abgrund, R: Harry Piel, 1933
– Die Buntkarierten, R: Kurt Maetzig, 1948/49
– Semmelweis – Retter der Mütter, R: Georg C. Klaren, 1949/50
– Epilog (Alternativtitel: Das Geheimnis der Orplid), R: Helmut Käutner, 1950
– Die lustigen Weiber von Windsor, R: Georg Wildhagen, 1950
– Drei Tage Angst, R: Erich Waschneck, 1952
– Der fröhliche Weinberg, R: Erich Engel, 1952
– Pension Schöller, R: Georg Jacoby, 1952
– Emil und die Detektive, R: Robert A. Stemmle, 1954
– Roman eines Frauenarztes, R: Falk Harnack, 1954
– Himmel ohne Sterne, R: Helmut Käutner, 1955
– Der letzte Mann, R: Harald Braun, 1955
– Des Teufels General, R: Helmut Käutner, 1955
– Vatertag, R: Hans Richter, 1955
– Zwei blaue Augen, R: Gustav Ucicky, 1955
– Fuhrmann Henschel, R: Josef von Baky, 1956
– Liebe (Uragano del Po; Alternativtitel: Vor Rehen wird gewarnt, Angelina), R: Horst Hächler , 1956
– Made in Germany, R: Wolfgang Schleif, 1956 Der tolle Bomberg, R: Rolf Thiele,
– Der Czardas-König. Die Emmerich-Kalman-Story, R: Harald Philipp, 1958
– Nachtschwester Ingeborg, R: Geza von Cziffra, 1958
– Vater, Mutter und neun Kinder, R: Erich Engels, 1958
– Freddy, die Gitarre und das Meer, R: Wolfgang Schleif, 1959
– Freddy unter fremden Sternen, R: Wolfgang Schleif, 1959
– Rosen für den Staatsanwalt, R: Wolfgang Staudte, 1959
– Vertauschtes Leben, R: Helmut Weiss, 1961
– Affäre Blum, R: Robert A. Stemmle, 1962
– Das Mädchen und der Staatsanwalt, R: Jürgen Goslar, 1962
– Musikalisches Rendezvous, R: Gottfried Kolditz, 1962
– Mamselle Nitouche, R: (?),1963
– Piccadilly null Uhr 12, R: Rudolf Zehetgruber, 1963
Die zahlreichen TV-Auftritte können nicht komplett angegeben werden
– Serie „Großer Mann, was nun?“ (TV) , 1967
– Serie: „Der Kommissar: Das Ungeheuer“, R: Dietrich Haugk (TV), 1969
– Serie „Motiv Liebe: Goldener Käfig“ (TV), 1972
– Serie „Die Powenzbande“,R: Michael Braun (TV), 1973
– Heinrich Zille, R: Rainer Wolffhardt (TV), 1977
– Wanderung durch die Mark Brandenburg, R: Eberhard Itzenplitz (TV) 1986
Filmographie Steffie Spira
– Des Haares und der Liebe Wellen, R: Walter Ruttmann, 1929
– Die Brücke, R: Artur Pohl, 1948/49
– Der Untertan, R: Wolfgang Staudte, 1951
– Schneewittchen, R: Gottfried Kolditz, 1961
– Florentiner 73, R: Klaus Gendries, 1971
– Die große Reise der Agathe Schweigert, R: Joachim Kunert, 1972
– Neues aus der Florentiner 73,R: Klaus Gendries, 1974
– Die Schüsse der Arche Noah, R: Egon Schlegel, 1982
– Blonder Tango, R: Lothar Warneke, 1985
– Fahrschule, R: Bernhard Stephan, 1985/86
– Die Schauspielerin, R: Siegfried Kuhn, 1988
– Apfelbäume,R: Helma Sanders
Entnommen aus
Styn, Gaby: Auf dem weißen Rößl zum Alexanderplatz. Camilla Spira und ihre Schwester Steffie. In: Augen-Blick. Marburger Hefte zur Medienwissenschaft. Heft 33: Flucht durch Europa. Schauspielerinnen im Exil 1933-1945 (2002), S. 108–130. DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/1539.

Views: 148