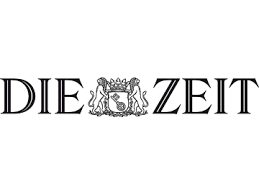Von Stefan Berkholz
Berlin-Wilmersdorf, 15. März 1933. Es ist noch nicht ganz hell, grad 8 Uhr. Großrazzia im Südwesten der Stadt. Mehrere Hundertschaften Polizei, preußische Polizei noch, mit Unterstützung von SA-Braunhemden, riegeln ein Gebiet ab, das drei große Wohnblocks umfaßt: Rund 800 Wohnungen mit vielleicht 1000, 1500 oder 2000 Bewohnern, so genau weiß das keiner, weil hier manche unangemeldet wohnen und zur Untermiete.
Goebbels’ Angriff, „das deutsche Abendblatt in Berlin für die Unterdrückten, gegen die Ausbeuter“, weiß zu berichten: „Rund um den Laubenheimer Platz befinden sich die sogenannten Künstlerkolonien, in denen ohne jede Frage die geistigen Urheber aller kommunistischen Umtriebe ihren Sitz haben. Meist handelt es sich bei ihnen um jüdische Literaten und Salonbolschewisten.“ Auf einem Photo wird „eine Gruppe der verhafteten jüdisch-bolschewistischen Mordhetzer“ präsentiert.
Der Propaganda-Erfolg ist gelungen, selbst der Frankfurter Zeitung ist die Aktion eine Meldung auf der ersten Seite wert. Es ist die erste großangelegte Razzia in Berlin nach dem Reichstagsbrand und, wie der Angriff hinzufügt: „Man kann schon jetzt sagen, daß mit dieser Aktion eine der schlimmsten bolschewistischen Pestbeulen Berlins aufgestochen wurde.“
Die Ausbeute ist für die Nazis freilich gering: Vierzehn Anwohner hat man als Verhaftete vorführen können, darunter den jüdischen Redakteur Walter Zadek, Günther Ruschin und Curt Trepte, beide Schauspieler und Mitglieder der kommunistischen Avantgardebühne „Truppe ’31“, Theodor Balk, einen jüdischen Schriftsteller, der schnell wieder zu entlassen ist, weil er einen ausländischen Paß besitzt, Peter Martin Lampel, das Enfant terrible der Bühnendichter, Manès Sperber, auch er noch zufällig da, bei einer Freundin untergeschlüpft …
Vielen anderen Bewohnern dieser drei Häuserblocks ist es noch rechtzeitig gelungen, die vierzehntägige Galgenfrist seit dem Reichstagsbrand zur Flucht zu nutzen: Ernst Bloch ist am 6. März nach Zürich ausgewichen, der „Barrikaden-Tauber“ Ernst Busch flieht am 9. März nach Holland, der Expressionist Karl Otten am 12. März nach Spanien, Gustav Regler hält sich im Saarland auf.
Andre befinden sich grad nicht in der Stadt, sind beruflich unterwegs, zu Gast bei Freunden: Walter Hasenclever ist in Frankreich, Arthur Koestler reist durch die Sowjetunion, der Schauspieler Leonhard Steckel, Jude und politisch kompromittiert durch seine Engagements bei Piscator, ist auf Gastspielreise in Skandinavien, Erich Weinert hält gerade Vorträge in der Schweiz, Axel Eggebrecht ist zu einer Bekannten in die Lausitz gezogen. Und der meistgehaßte Feind der Nazis, Kurt Tucholsky, wohnte nie in der Künstlerkolonie, lebt seit Jahren im Ausland. Seiner Frau Mary, die allerdings zu dieser Zeit dort eine Bleibe hat, gelingt es während der Durchsuchung wie durch ein Wunder, seine Briefe vor dem Zugriff zu bewahren.
Die Nazis können eine großangelegte „Ausräucherung“ bejubeln, die meisten ihrer Feinde haben sich in Sicherheit gebracht. In diesen drei so verhaßten Wohnblocks aber beginnt eine weitere kleine Geschichte der Vertreibung, die bis heute nicht geschrieben ist…
Angefangen hatte alles ganz harmlos und in dem Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit, wie vieles in jenen Jahren der jungen Republik. „Die Stadt Berlin will eine Künstlerkolonie bauen“, hieß es im Herbst 1926 nach langwierigen Bemühungen. Die Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger und der Schutzverband deutscher Schriftsteller hatten sich geeinigt, die „Gemeinnützige Heimstätten-Gesellschaft m.b.H., Künstlerkolonie“ zu gründen, künftig für die Vergabe und Verwaltung der Wohnungen zuständig. Die Eintragung im Handelsregister besagte, daß „insbesondere die Angehörigen dieser beiden Gewerkschaften und ausschließlich Minderbemittelte“ das Wohnrecht in der Kolonie erhalten sollten.
Die Stadt unterstützte das Projekt. Die Wohnungen sollten stark subventioniert werden, es begann der große Andrang auf die Listen. Wer Mitglied in einem der beiden Berufsverbände war, trug sich schleunigst ein, denn Berlin war zwar zu dem künstlerischen Zentrum gewachsen, doch die Nachfrage konnte dem Angebot längst nicht mehr folgen. Ein Heer von engagementslosen Schauspielern zog durch die Stadt, Schriftsteller versuchten, mit dem kargen Honorar einiger Veröffentlichungen über die Runden zu kommen. Wenige konnten prächtig leben, die meisten hielten sich grad so am Existenzminimum. Zudem war die Wohnungssituation in Berlin allgemein miserabel.
Wie ein Blitz verbreitete sich die Meldung in Künstlerkreisen. Jo Mihaly, damals Ausdruckstänzerin, heute Schriftstellerin, die erste Frau von Leonhard Steckel, erinnert sich: „Für alle Künstler war es eine große Erlösung, als wir hörten, daß die Bühnengenossenschaft einen Bau plant für Künstler – nicht nur Bühnenangehörige, sondern Künstler aller Sparten, also auch Maler, Bildhauer, Musiker, Dichter. Das Gros der Schauspieler und Künstler zog dorthin, mit Ausnahme natürlich derjenigen, die bereits einen Namen hatten und in ihren Villen wohnten.“
Die Gegend war noch ländlich, still und grün, ein Gebiet mit Feldern und Schrebergärten. Man wohnte fernab des Metropolentrubels – und war doch schnell im Zentrum durch die nahe gelegene U-Bahnstation Breitenbachplatz. Im April 1928 war der erste Block fertiggestellt, im Winter 1931 der dritte und letzte. Fünfgeschossige Häuserreihen sind entstanden. Die Wohnungen hell und sachlich im Zuschnitt, meist mit Balkon oder Loggia; Gemeinschaftsküchen und andere gemeinsame Einrichtungen erleichtern das Zusammenleben. „Die Künstlerkolonie dürfte eine besondere Sehenswürdigkeit in Berlin werden“, heißt es in einer Bezirkszeitung, „und auch große Anziehungskraft auf Fremde, die die Reichshauptstadt besuchen, ausüben.“
Vor allem war sie zunächst Anziehungspunkt und Wunsch jedes notleidenden Künstlers in der Stadt. Eine gemeinsame Idee, eine gemeinsame künstlerische Zielsetzung stand nicht in der Satzung. Die Bewohner waren froh, eine preiswerte Wohnung erhalten zu können. Man wollte seine Ruhe, respektierte den anderen und seine Arbeit, konnte sich austauschen, traf sich auf der Straße oder in der U-Bahn, auf dem Weg zur Arbeit vielleicht.
Man lebte leicht verstiegen vor sich hin, klatschte und tratschte und war ordentlich eifersüchtig auf den anderen oder die andere – doch im großen und ganzen lebte man zufrieden nebeneinanderher.
Aber die politische Lage spitzte sich zu, es ging auf Polarisation, ein „Entweder-Oder“, in Künstlerkreisen war „man“ meist links – die Künstlerkolonie am Laubenheimer Platz wird in der Endphase der Weimarer Republik zum Kristallisationspunkt für die Möglichkeiten einer antifaschistischen Front. Klassenbewußte Arbeiter aus dem Norden und Osten der Stadt kommen vorbei, um sich dies „Schauspiel“ aus der Nähe zu betrachten: eine „rote Insel“ inmitten von traditionell braun geflaggten Straßen. Die Künstlerkolonie wird tatsächlich zu einer Sehenswürdigkeit.
Die Zeit wurde radikal. Viele Tausende verelendeten, man solidarisierte sich, organisierte sich. So draußen im Leben, so hier in der Künstlerkolonie. Gustav Regler schreibt in seinen Erinnerungen: „Es waren billige Wohnungen, und doch bezahlte kaum einer seine Miete; weder die Gehälter noch die sogenannten Einkünfte der freien Berufe reichten aus. In den meisten Behausungen lag nur eine Matratze am Boden. Die Künstler aßen von Seifenkisten, über die sie Zeitungen gebreitet hatten; keiner verhungerte, man half sich gegenseitig und wanderte von Wohnung zu Wohnung, man roch, wo einer Arbeit gehabt hatte und etwas Speck und Käse zu finden war. Die Gastfreundschaft war keine Form der Bohème, sondern das stillschweigende Gesetz von Landsknechten, die einen Krieg erwarteten.“
Man spricht von der „Hungerburg“, der „Stempelburg“, der „Tintenburg“, und meint die Künstlerkolonie. Das Zentralorgan der KPD, die Rote Fahne, hatte im November 1928 noch gegen die verspießerten Anwohner gewettert, die da „gern mit ihrer politischen Indifferenz poussieren“ und „gesellschaftlich etwas sein wollen, was sie ihrer wirtschaftlichen Basis nach nicht sind“. Die sich weiter verschlechternden Zustände sorgen bald für ein anderes Bild. Die KPD gründet eine Zelle im Künstlerblock, ihre Propaganda stößt auf fruchtbaren Boden. Regelmäßig kommt eine Gruppe von fünfzehn bis zwanzig Sympathisanten und Parteimitgliedern zusammen, meist im sogenannten Hauptquartier, der Parterrewohnung von Alfred Kantorowicz: unter ihnen Arthur Koestler, der Psychoanalytiker Wilhelm Reich, der Kunsthistoriker Max Schroeder, Erich Weinert, verschiedene Schauspieler des Avantgardetheaters „Truppe ’31“. Karola Bloch schreibt in ihren Erinnerungen: „In die Sitzungen meiner Parteizelle ging ich gerne. Es war ein Kreis von Genossen und Freunden, der sich da traf. Der gemeinsame Kampf gegen den Faschismus beherrschte uns so, daß persönliche Probleme zweitrangig wurden. Und individuelle Nöte verblaßten vor der Kraft der kommunistischen Idee.“
Es war Kampf, Heimat, individuelle Not, Familienersatz, innere Überzeugung, was sie zusammentrieb. Auf den Straßen wird agitiert, in den Höfen gesungen, geredet und diskutiert, man befindet sich in Aufbruchstimmung. „Wir setzten auf Kampf“, schreibt Regler und fügt hinzu: „Am Ende liebten alle den Kriegszustand. Er brachte das Fieber, das alle normale Tagesordnung verbrannte wie Zunder.“
In der Künstlerkolonie hält sich der Glaube, daß der Faschismus zu besiegen ist. Im Juli 1932 kommt es zur Gründung eines „antifaschistischen Schutzbundes“. Der Zusammenschluß ist überparteilich, zur Gründungsversammlung kommen über einhundert Bewohner des Blocks. Spontan bildet sich ein fünfköpfiger Ausschuß, der die Organisation leiten soll: Der parteilose Axel Eggebrecht wird zum Leiter erklärt, Unterstützung bekommt er von den Kommunisten Kantorowicz und Schroeder, dem Schauspieler Albert Arid, einem Anarchisten, sowie dem sozialdemokratischen Journalisten Herman Budzislawski.
Axel Eggebrecht schreibt in seinen Erinnerungen: „Rings um unseren Laubenheimer Platz sah man nur die Farben der Republik und das revolutionäre Rot. Und es blieb nicht beim Flaggenstreit. SA zog provozierend durch unser Viertel. Spätabends wurden einzelne Heimkehrer am U-Bahnhof Breitenbachplatz angerempelt, man verabredete sich zum gemeinsamen Weg, das half nur vorübergehend. Als die Bedrohung nicht aufhörte, gründeten wir einen Selbstschutz. Binnen weniger Wochen schloß sich die Mehrheit der Bewohner an, ohne Rücksicht auf politische Unterschiede.“
In den Erinnerungen einiger Zeitgenossen schwingt leise Kriegsbegeisterung mit, Abenteuerstimmung, die von individuellen Nöten ablenkt. Waffen werden gesammelt, gefüllte Wasserflaschen als Wurfgeschosse auf den Fensterbrettern bereitgehalten, ja selbst Gräben ausgehoben, als Hitler mit dem „Marsch auf Berlin“ droht. Ein (Kriegs-) Spiel, auch dies? Gustav Regler: „Es ging das Gerücht, daß unser Block als Festung organisiert sei. In Wirklichkeit hätte ein Unteroffizier mit vier Mann jede Wohnung ausheben können.“
Und dennoch wurde hier etwas begonnen, was anderswo gar nicht versucht wurde: ein überparteiliches Bündnis über die Köpfe und Barrieren von Funktionären und Parteidoktrinen hinweg. Karl Otten beschrieb die Ziele dieses Zusammenschlusses in einer Beilage des Berliner Tageblatts deutlicher – und utopischer zugleich: „Diese antifaschistische Bindung wird in kurzer Zeit jenen Schritt ins Volk tun – freiwillig – und durch Vorträge, Rezitationen, Vorlesungen und Debatten das Zusammenleben, nicht Nebeneinanderleben, verwirklichen. […] Jetzt haben die großen Organisationen das Vorbild, schafft uns Raum nach außen, nach Frankreich, England, Rußland, Amerika. Wir wollen das Erbe unserer Dichter und Philosophen nicht durch Schwindel vernichten lassen – wenn wir Deutschland gegen den Faschismus verteidigen, verteidigen wir Europa. Europa hat die Pflicht, uns in diesem Kampfe zu unterstützen.“
In der Künstlerkolonie gilt es zunächst, die täglichen Sorgen und Nöte des Einzelnen zu lindern. Drei Viertel der Bewohner sind engagements- und arbeitslos, die meisten von ihnen mit der Miete im Rückstand. Die Mieten sind mittlerweile höher als jene privater Wohnbaugesellschaften: Der bekannte Grundstückseigner und Spekulant Haberland, der die Baugesellschaft kontrolliert, hat die Erlöse in die Höhe treiben lassen.
Gerichtsvollzieher werden zu Stammkunden der Heimstätten-Gesellschaft, Entmietungen werden angedroht, die Mieter protestieren. Der „Selbstschutz“ packt zu, wenn wieder einmal eine Zwangsräumung durchgeführt werden soll. Und, was die politische Verwirrung und zeitweilige Verwischung von Parteigrenzen noch deutlicher macht: Die kommunistische Welt am Abend kann darüber berichten, daß „vorbeikommende Arbeiter aus Steglitz und sogar eine Anzahl uniformierter SA-Leute sich energisch an der Demonstration gegen die Brutalität der Verwaltung beteiligten. Eine wirkliche Einheitsfront aller Werktätigen bildete sich: Künstler, Schauspieler, Schriftsteller, Arbeiter und Angestellte, Kommunisten, Sozialdemokraten und Nationalsozialisten fanden sich unter der Führung des Schutzbundes zusammen.“ All dies drei Monate vor Hitlers Machtübernahme!
In den folgenden Tagen, Wochen und Monaten kommt es immer wieder zu erregten Zwischenfällen, die Presse berichtet, teilweise in großer Aufmachung, über die Vorkommnisse, die Bewohner machen Propaganda, so gut sie können, in Zeitungen, auf Demonstrationen oder einem Ball der Bühnengenossenschaft. Einige der notleidenden Künstler ziehen weg, weil sie dem Druck nicht mehr standhalten können – die Heimstätten-Gesellschaft setzt nun auch sogenannte Außenstehende ein, zahlungsfähige Mieter, die nicht unbedingt Mitglied einer der beiden Genossenschaften sein müssen: Ingenieure, Bankbeamte, Geschäftsführer.
Im Januar 1933 scheint der verzweifelte Kampf gegen Entmietung und wirtschaftliche und soziale Entwurzelung einen ersten Erfolg zu erzielen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft gibt den Forderungen der vereinten Mieter nach und verfügt eine Mietsenkung um acht Prozent. Zugleich aber wird drei Mietern zum 1. April die Wohnung gekündigt – den Schriftstellern Karl Otten und Siegmund Reis sowie dem Schauspieler Rolf Gärtner, jenen drei also, die sich in den vergangenen Wochen als Mieterräte besonders exponiert haben. Es kommt zu Protestschreiben, Kundgebungen und Demonstrationen – die große Entscheidung fällt woanders. Am 30. Januar 1933 ist Hitler Reichskanzler.
Einer derjenigen, der die Razzia am 15. März 1933 am eigenen Leib zu spüren bekam, ist Walter Zadek. Er war von 1925 bis 1929 Ressortleiter beim Berliner Tageblatt gewesen, hatte dann in der Künstlerkolonie in einer kleinen Wohnung einen Nachrichtendienst geführt, die Zentralredaktion für deutsche Zeitungen. Als Jude war er gebrandmarkt genug für die neuen Herren, seit drei Jahren war er nun auch noch bekannt durch die Verbreitung seines antifaschistischen Materials an etwa achtzig Zeitungen im gesamten Reich. Zudem hatte er wenige Wochen zuvor am U-Bahnhof Breitenbachplatz eine Rempelei mit Nationalsozialisten gehabt.
Zadek fällt seinen Häschern an jenem Morgen in die Hände. Der Völkische Beobachter hetzt: „Dieser jüdische Redakteur ist eins der typischen Beispiele für die vielen Brandredner und Wühler, die systematisch im Hintergrunde arbeiten. Zadek ist einer der vielen aus der kommunistischen Mörderzentrale, die die Befehle an die Unterwelt weitergaben, sein Büro und die Räume seiner Genossen sind die wirklichen Brutstellen des roten Terrors gewesen, der Tod so manches Kameraden ist hier beschlossen worden. Bei Herrn Zadek wurden drei scharf geladene Pistolen und eine Menge Munition gefunden…“
Ein ganz gefährlicher kommunistischer Rädelsführer also? Zadek ist nie Mitglied einer Partei gewesen, seine Arbeiten sind weniger politisch als die anderer, er selbst ein sorgfältiger Redakteur. Und die Pistolen? „Eines war ein alter Armeerevolver aus dem Krieg 1870“, erinnert sich der 91jährige Zadek heute, „aus der Zeit jedenfalls, als mein Vater Soldat war. Der war also nicht mehr brauchbar. Das zweite war eine Pistole mit langem Lauf für das Schießen auf Schießscheiben. Hat also auch mit Revolver nichts zu tun. Und das dritte war wirklich eine Waffe, für die ich einen Waffenschein hatte.“ Zadek hat immerhin noch das Glück, freizukommen und ins Exil zu gelangen wie die Mitverhafteten.
Und die Künstlerkolonie? Parteimitglieder finden nun Aufnahme in den Wohnungen, es kommt zu einem regen „Mieteraustausch“. Mehrere Hausdurchsuchungen sorgen dafür, daß auch die letzten der Gefährdeten verschwinden. Und doch versuchen einige, im verhaßten Viertel zu bleiben, sogar Untergrundarbeit zu leisten wie der Schauspieler Hans Meyer-Hanno, der 1945 umkommt. Wenig ist aus diesem Kapitel der Künstlerkolonie, den Jahren 33 bis 45, in Erfahrung zu bringen. Vom Bombeninferno auf Berlin bleibt die Siedlung glücklich verschont, die drei Blocks stehen noch heute so da, wie sie 1933 verlassen wurden, die Bäume sind gewachsen, manches ist verändert worden.
Die Menschen sind in alle Winde verstreut. Manche umgekommen in den tausendjährigen zwölf Jahren, einige wurden zurückgetrieben, in die DDR die einen, in die BRD die anderen, wieder andere blieben in der Schweiz, in Jugoslawien, in der Tschechoslowakei, Großbritannien, USA, Israel. Wenige brachten es fertig, ihrem Glauben über die Jahrzehnte treu zu bleiben; einige wurden hin- und hergeworfen vom einen Deutschland ins andere, manchen kam der Glaube an eine neue Gesellschaft bereits in den dreißiger Jahren abhanden.
Kaum etwas zeugt noch vom Geist, der hier einmal herrschte. Seit ein paar Jahren versucht eine bunt gemischte Vereinigung, die sich heute zerstreitet und morgen wieder neu gründet (aber ein Verein muß es ja sein!), krampfhaft an dem anzuknüpfen, was vor sechzig Jahren zerschlagen wurde. Im März 1988 wurde ein Feldstein auf den ehemaligen Laubenheimer Platz (heute: Ludwig-Barnay-Platz) gestellt, mit einer unscheinbaren Plakette: „Mahnmal für die politisch Verfolgten der Künstlerkolonie“. Nichts weiter. Kein Datum, keine Namen der Vertriebenen, keine Fakten, nichts. Ein Alibi, nicht mehr. Einige Erinnerungstäfelchen an Hauseingängen sind dazugekommen.
Kommunalpolitiker bekunden ein ums andre Mal guten Willen, grinsen von Grußworten und in ihrer Funktion als Schirmherren der alljährlichen „Künstlerfeste“ mit Currywurst und Ringelpiez – geschehen ist bis heute nichts. Die 750-Jahr-Feier ist vorbei, das Kulturjahr E 88, nichts geschah. „Das Stückchen Zeitgeschichte, das der ‚Rote Block‘ der sogenannten Künstlerkolonie damals war, bleibt noch in Zusammenhängen zu schreiben“ – merkte Alfred Kantorowicz in seinem „Deutschen Tagebuch“ an, 1964 veröffentlicht.
Besteht Interesse an dieser späten Wiedergutmachung? Zweifel kommen auf, wenn man durch die ruhigen Straßen der Siedlung schlendert. An einer Haustür, dort, wo einst Karl Otten wohnte, war bis vor einiger Zeit ein kleines Blechschild befestigt: „Betteln, Hausieren, Musizieren verboten.“ Jetzt ist es verschwunden, ein heller Fleck verrät noch, daß da mal was war.
Auf dem ehemaligen Laubenheimer Platz, dort, wo die Künstler einst ihre Gärten hatten, sind heute Blumenbeete angelegt, Rasenflächen abgesteckt, ein paar Bänke dazugestellt und das Schild: „Geschützte Grünanlage. Gesetz vom 3. 11. 1962.“ Dahinter ein dürftiger Kinderspielplatz, eingefaßt von einem bauchhohen Drahtzaun. Die Fassaden der Häuser sind von wildem Wein überwuchert, im Herbst leuchtet es flammendrot, im Sommer dunkelgrün…
Erkundigt man sich bei der GEHAG, der Gemeinnützigen Heimstätten-Aktiengesellschaft, erfährt man, daß „die Vergabe der Wohnungen ausschließlich durch die Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger erfolgt“. Immerhin, so hat wenigstens ein kleiner Teil der Kulturschaffenden immer noch einen Fuß in der Tür – gemäß des verträumten Poems, das einst in den Grundstein der Siedlung eingemeißelt ward: „Aus dem Nichts schafft Ihr das Wort / Und Ihr tragt’s lebendig fort / Dieses Haus ist Euch geweiht / Euch, Ihr Schöpfer uns’rer Zeit.“
Wer heute von dem Künstler-Berlin der zwanziger Jahre und seiner Wiederkehr träumt, sollte von diesem Ort wissen. Wer heute die intellektuelle „Metropole“ von morgen beschwört, sollte die kurze Geschichte der Kolonie am Laubenheimer Platz kennen. Denn Künstler leben nicht in Hochhäusern.
Views: 65