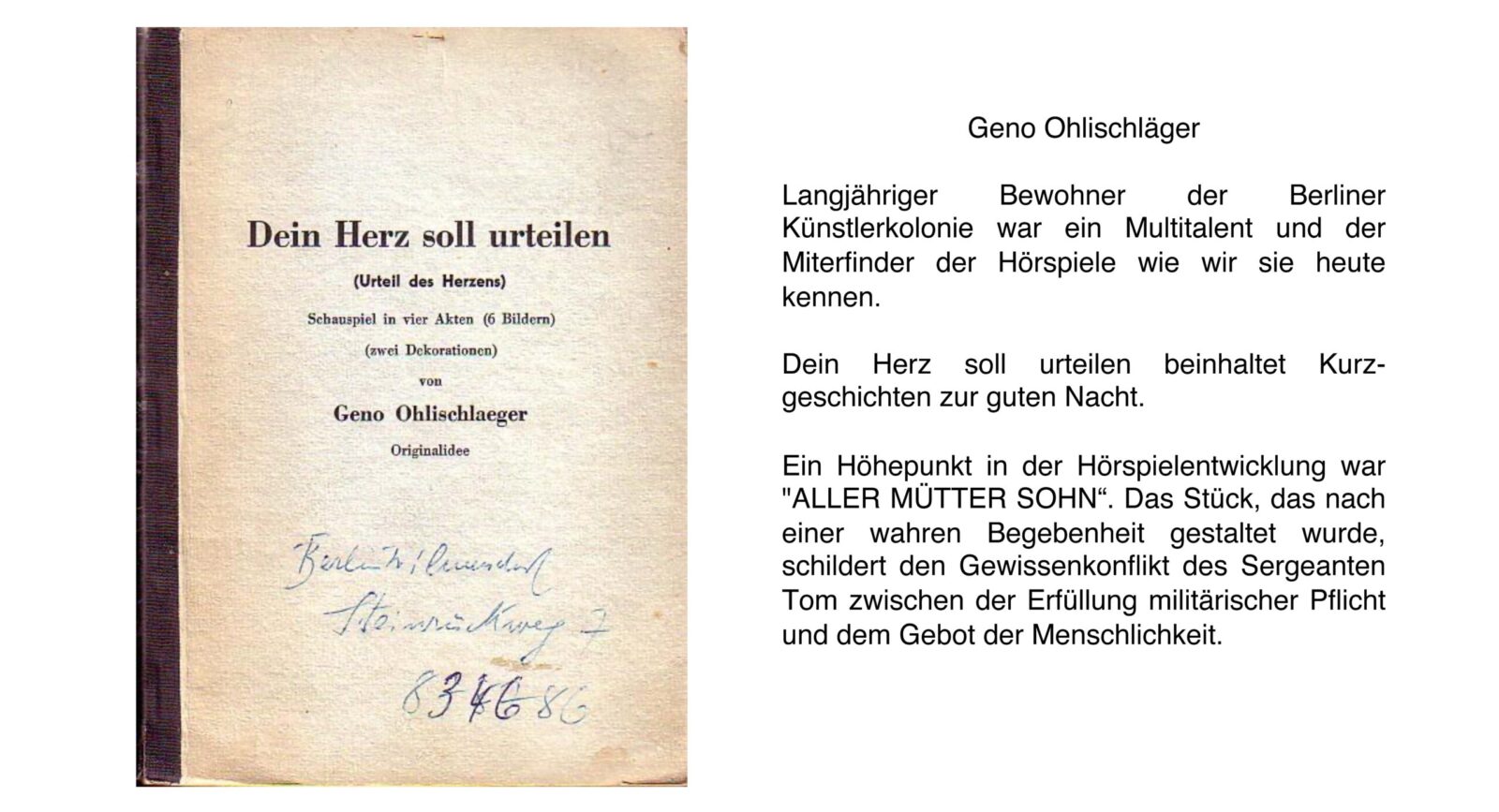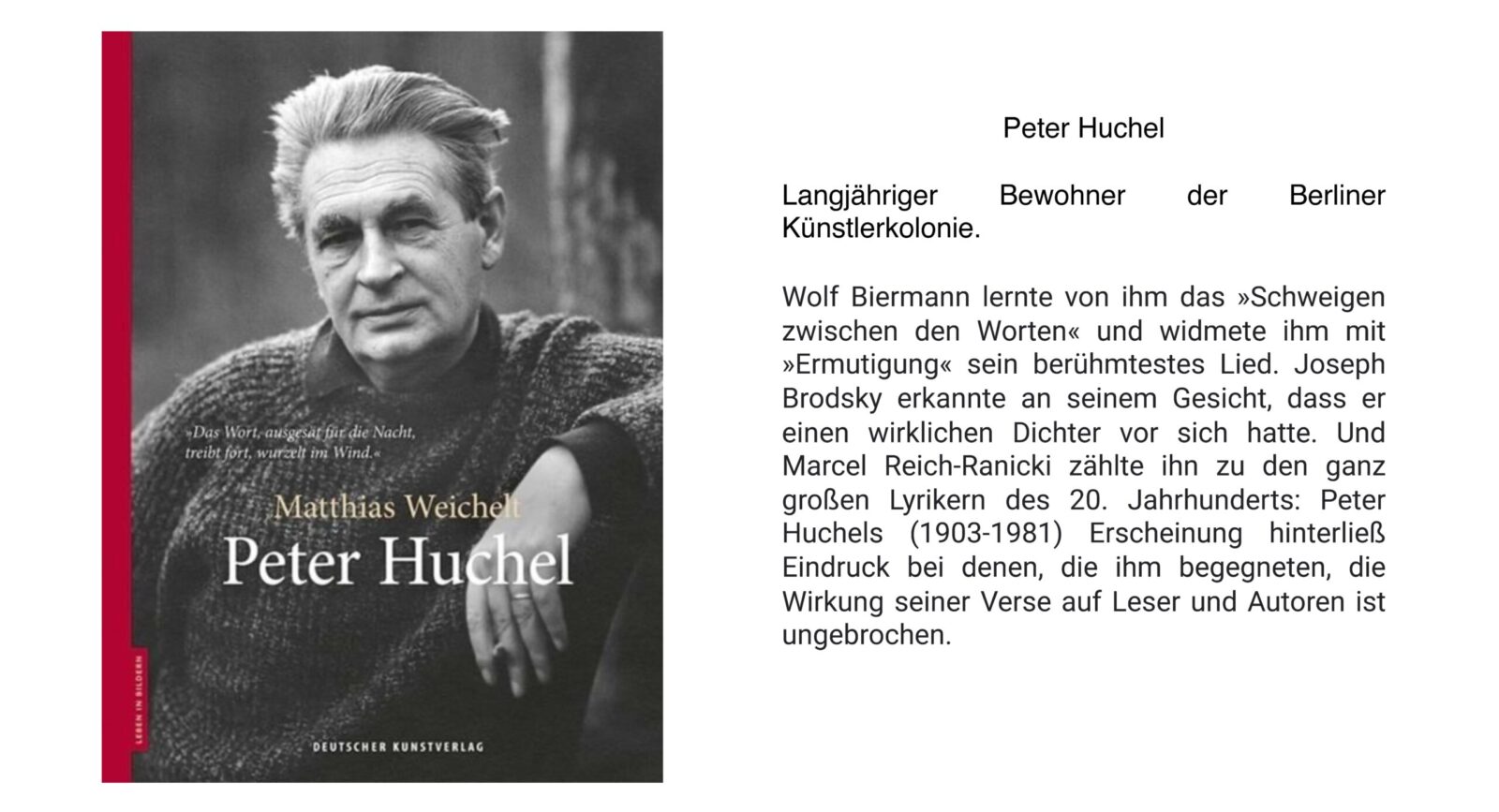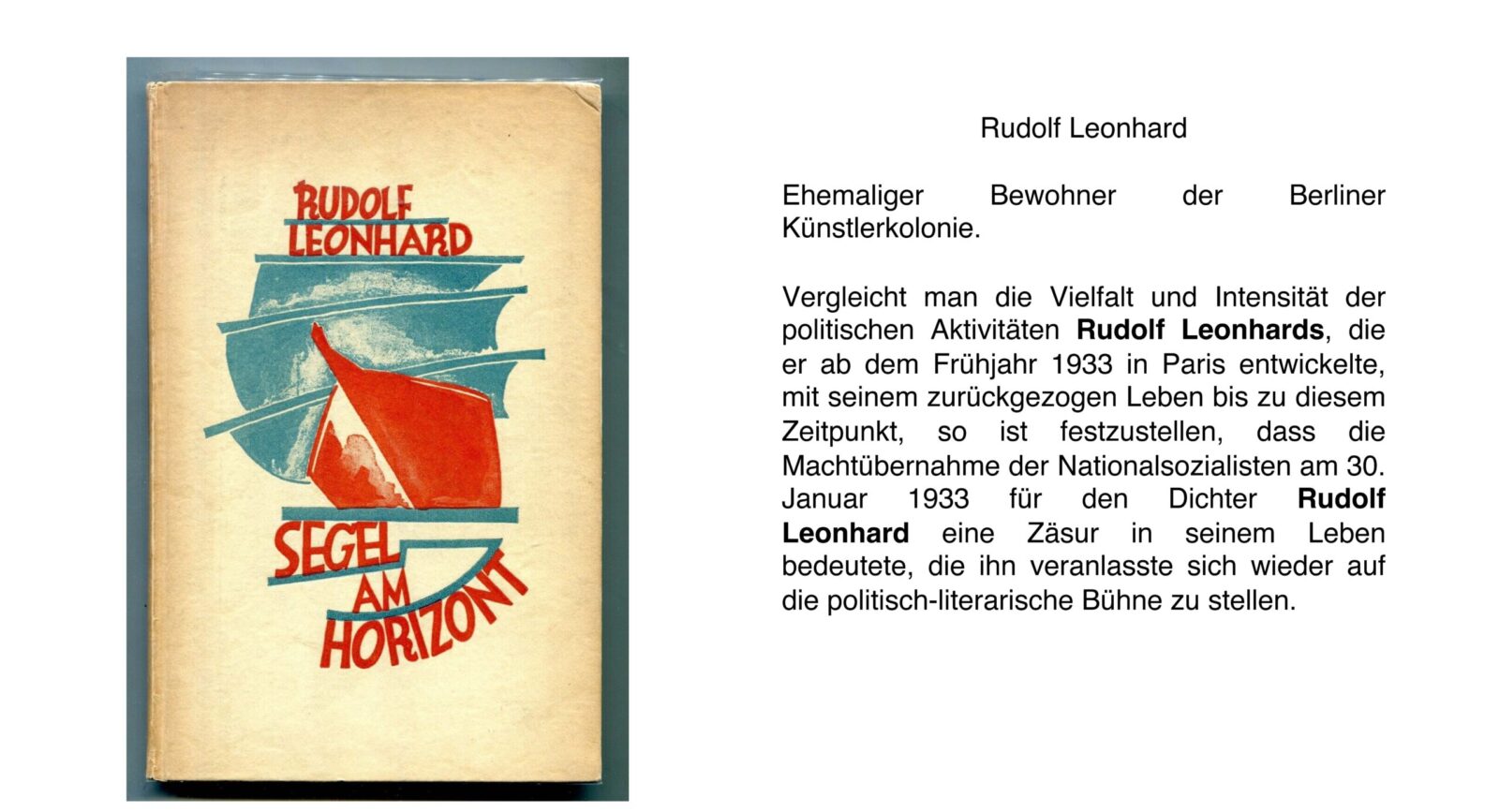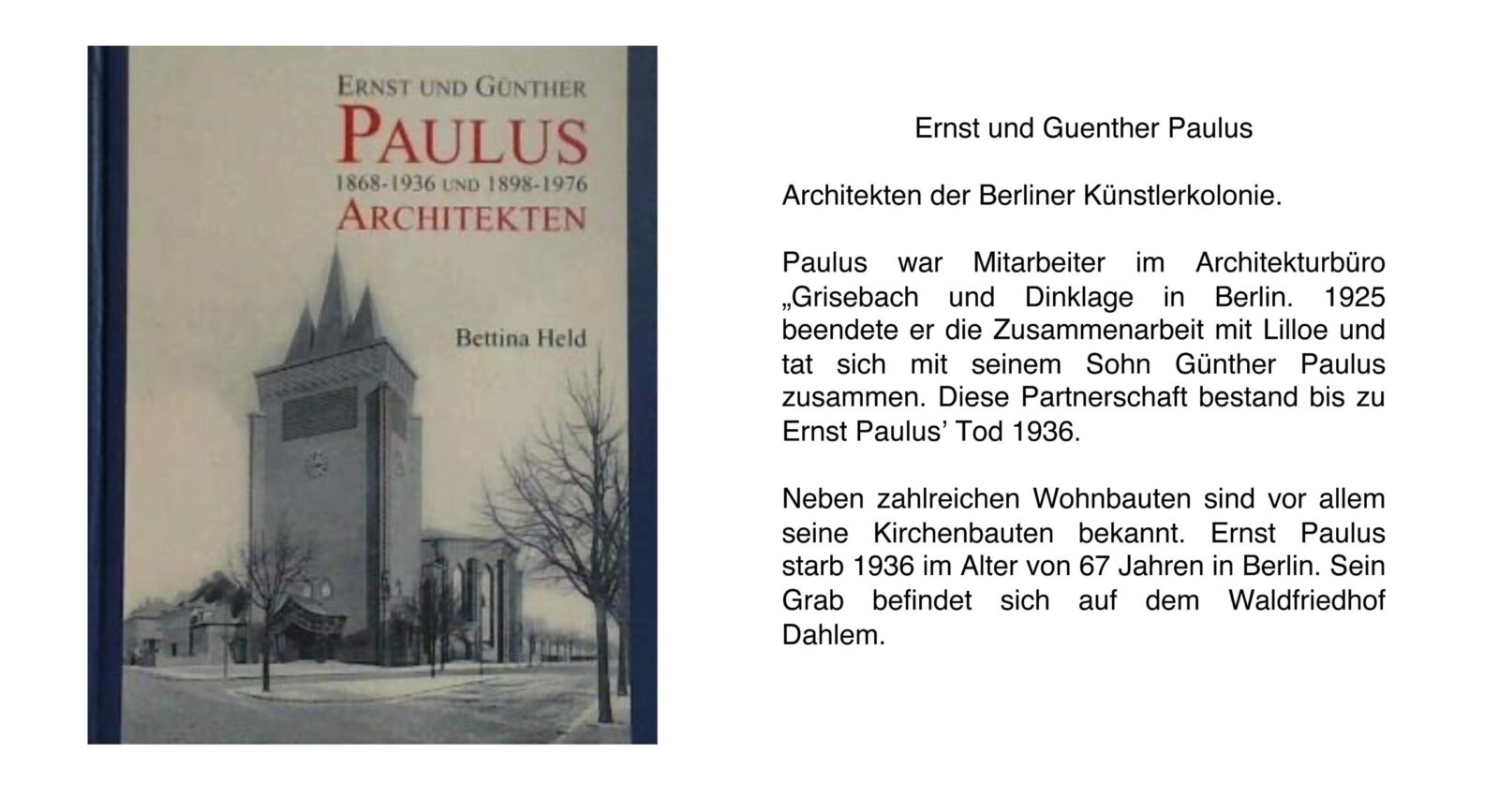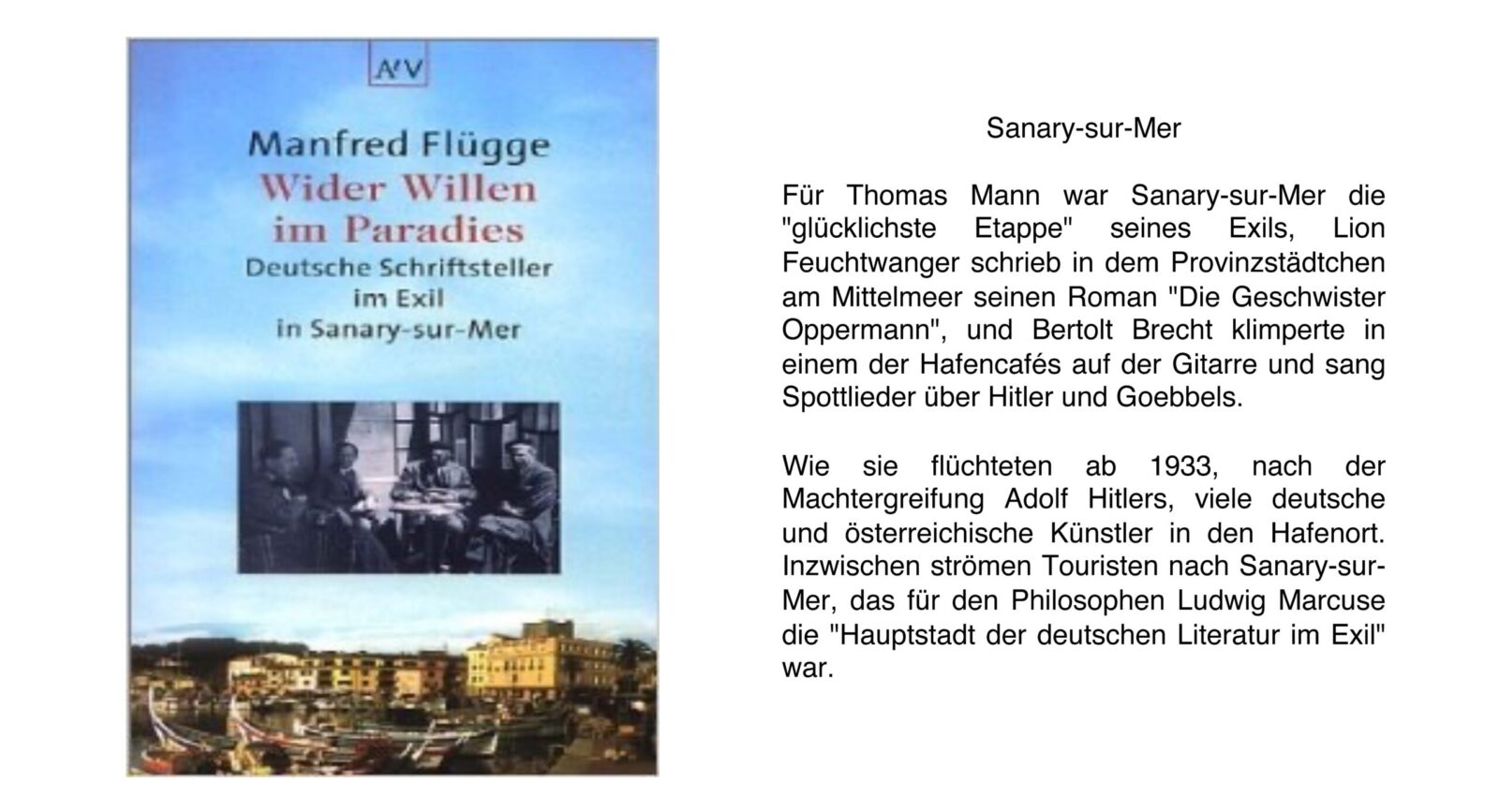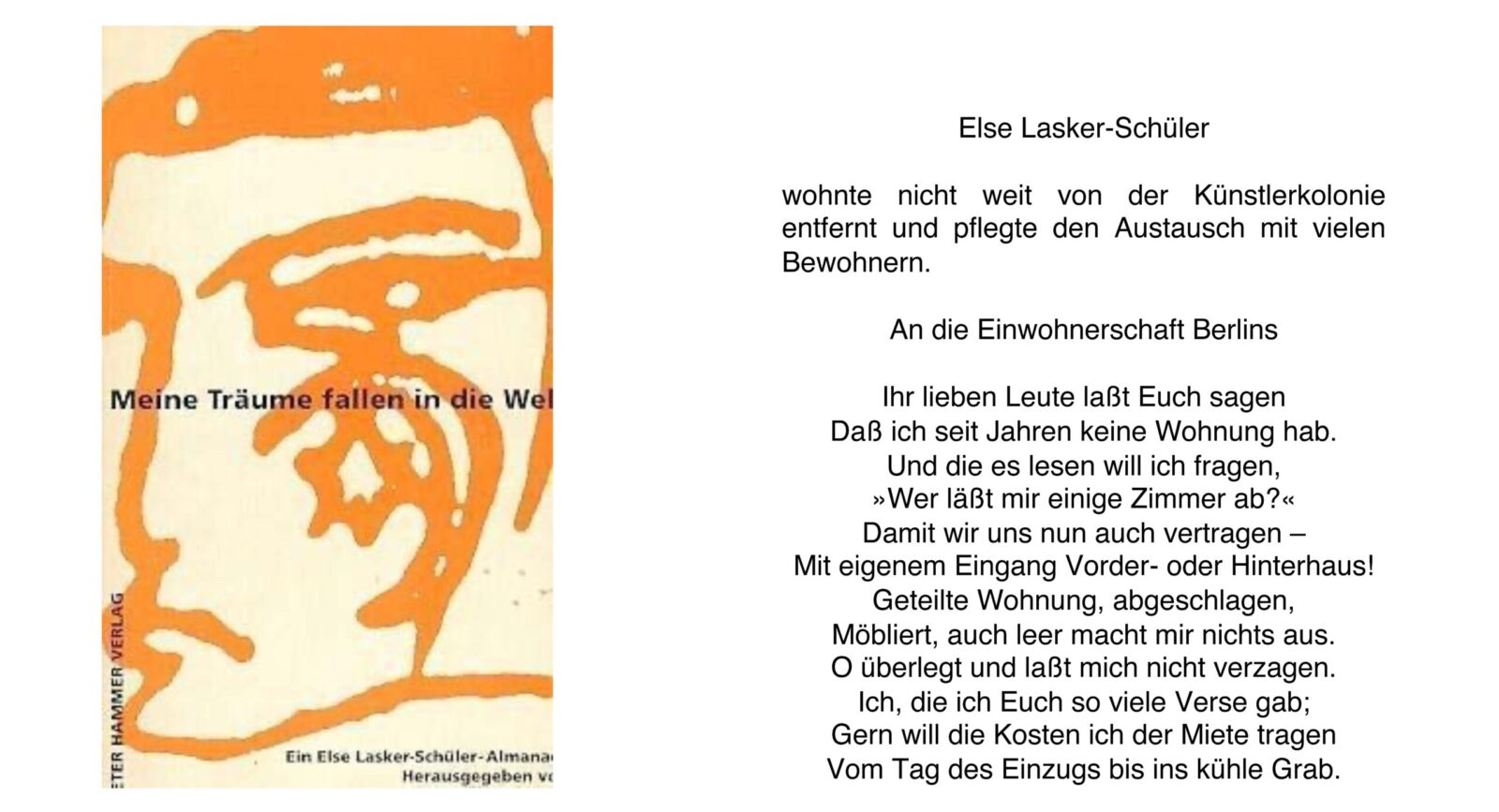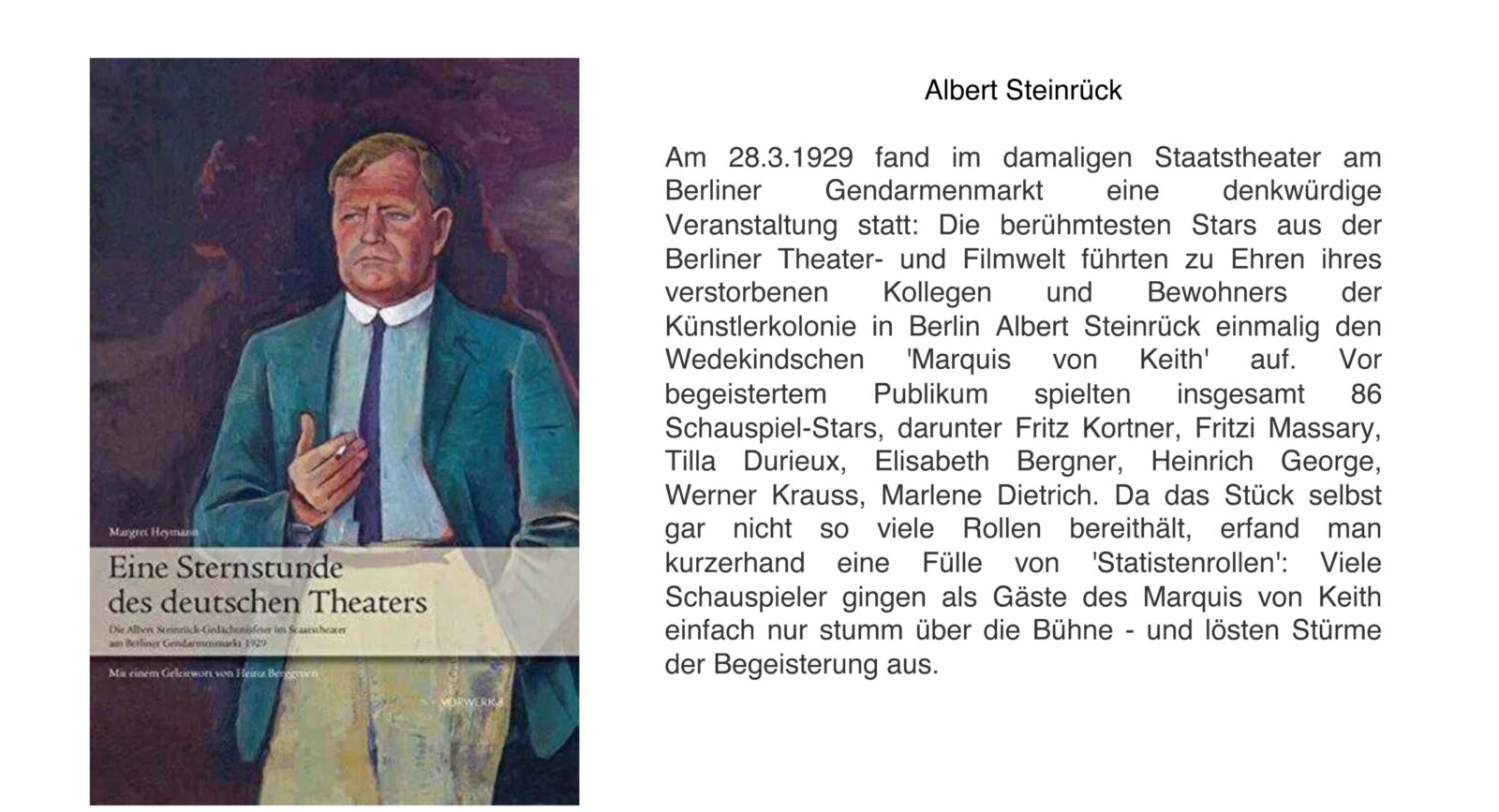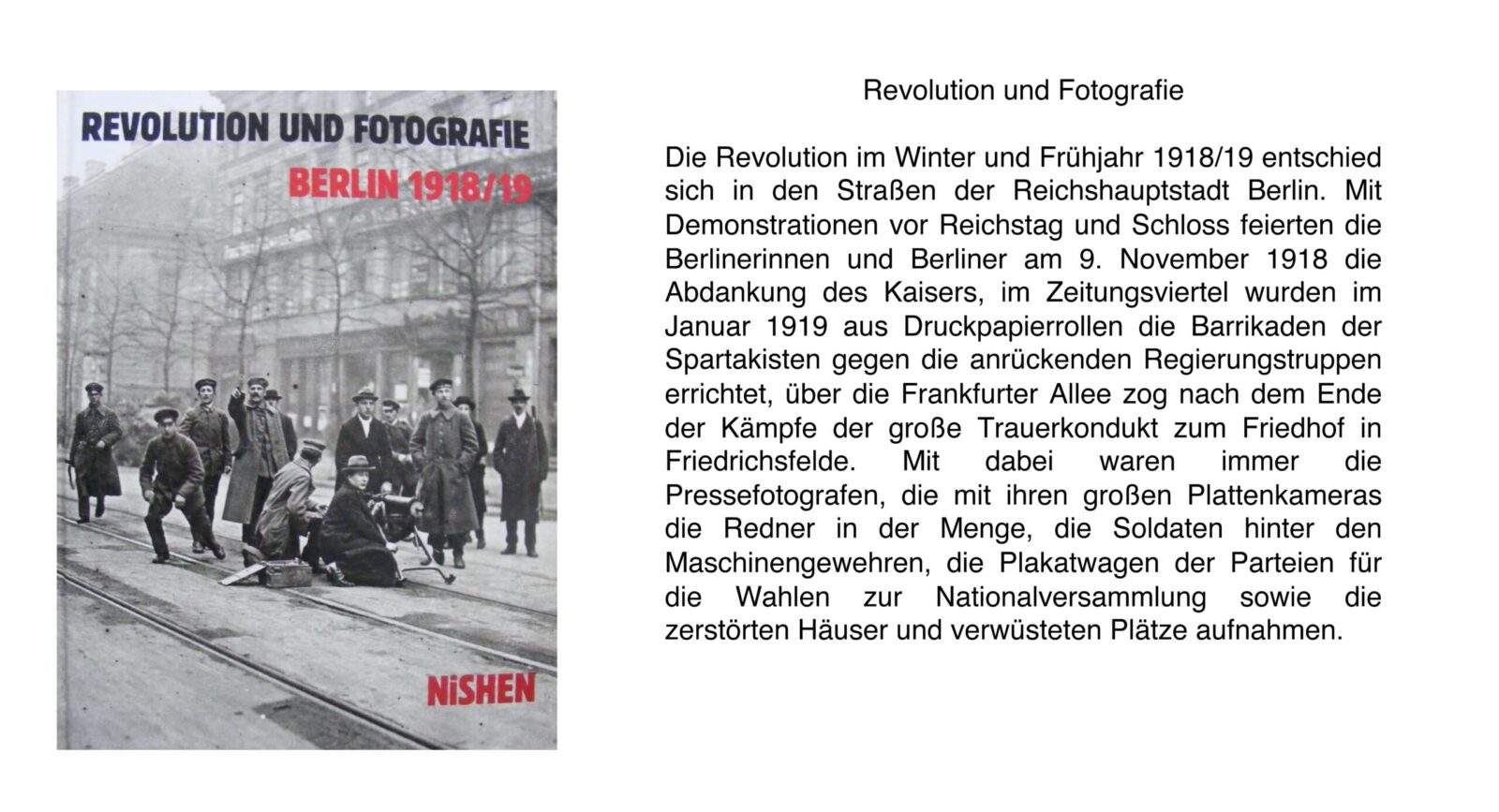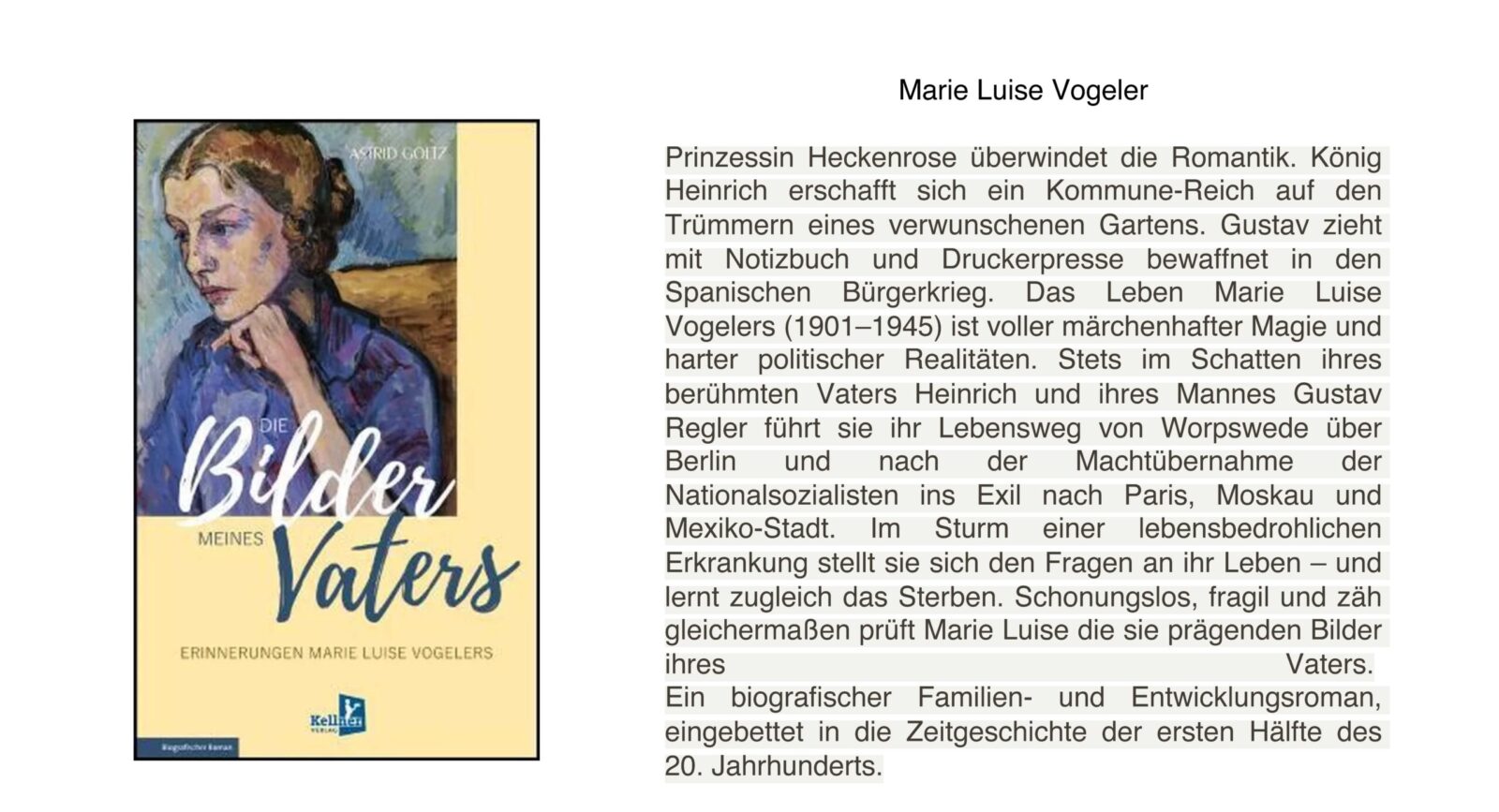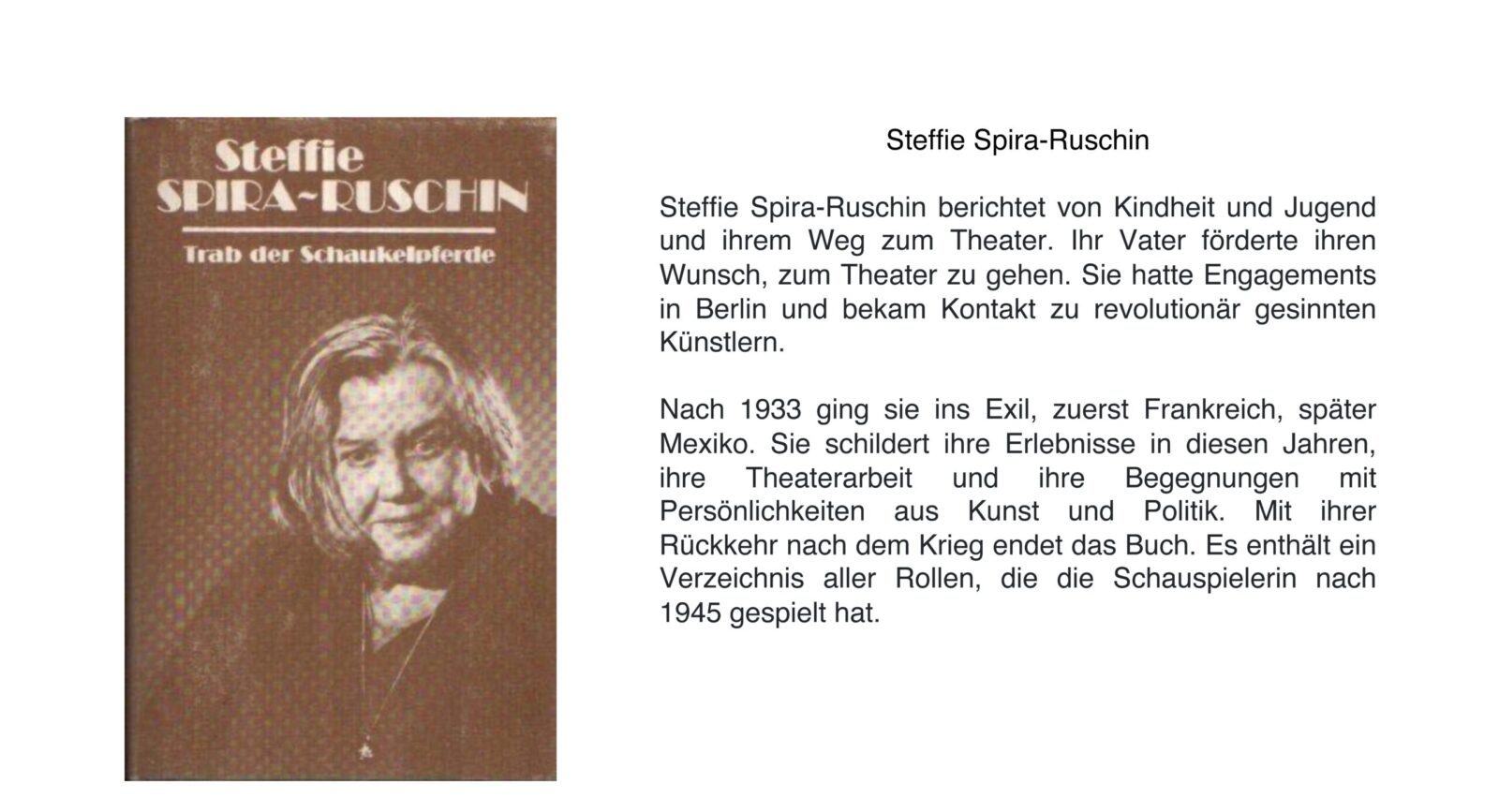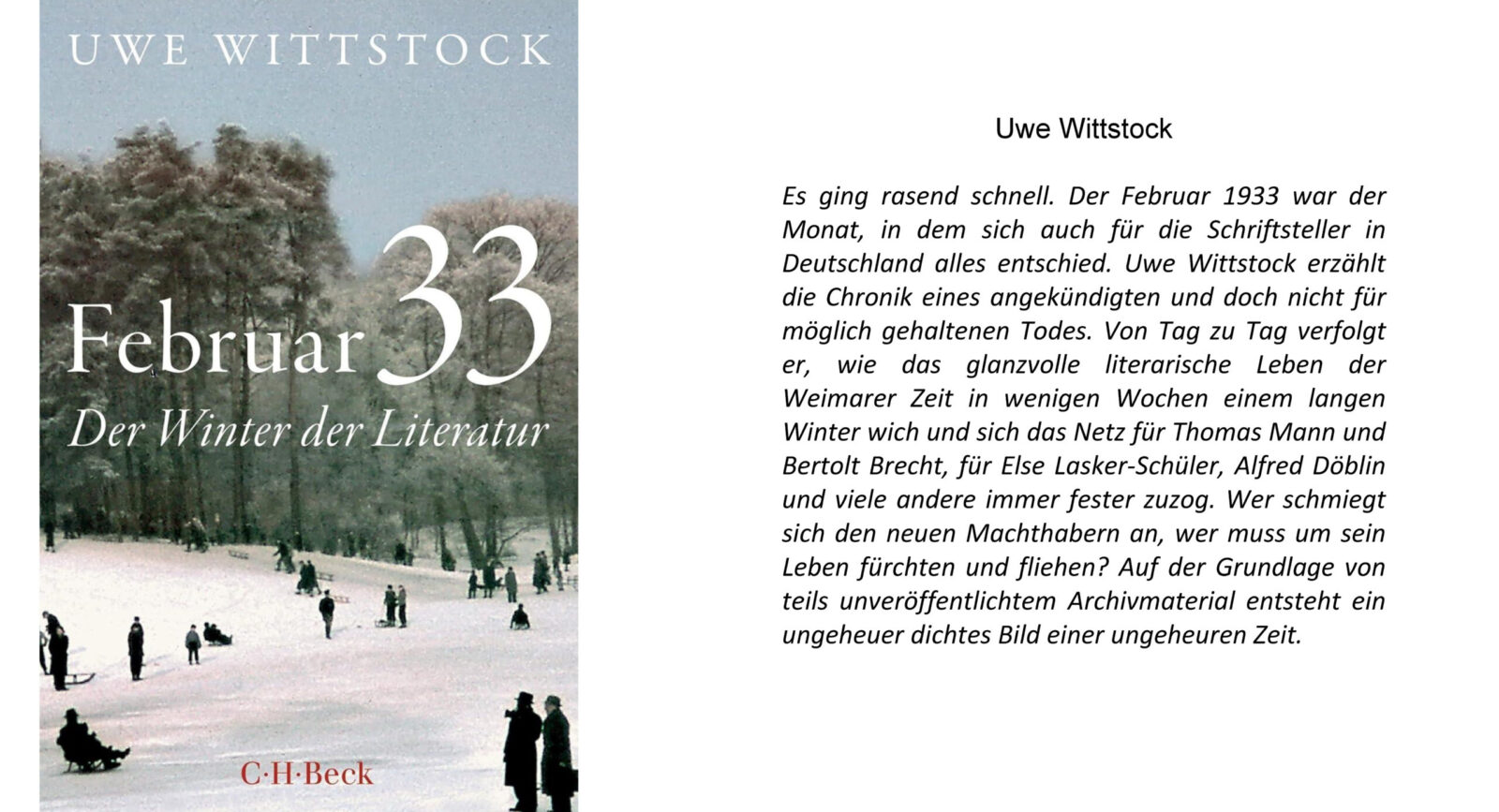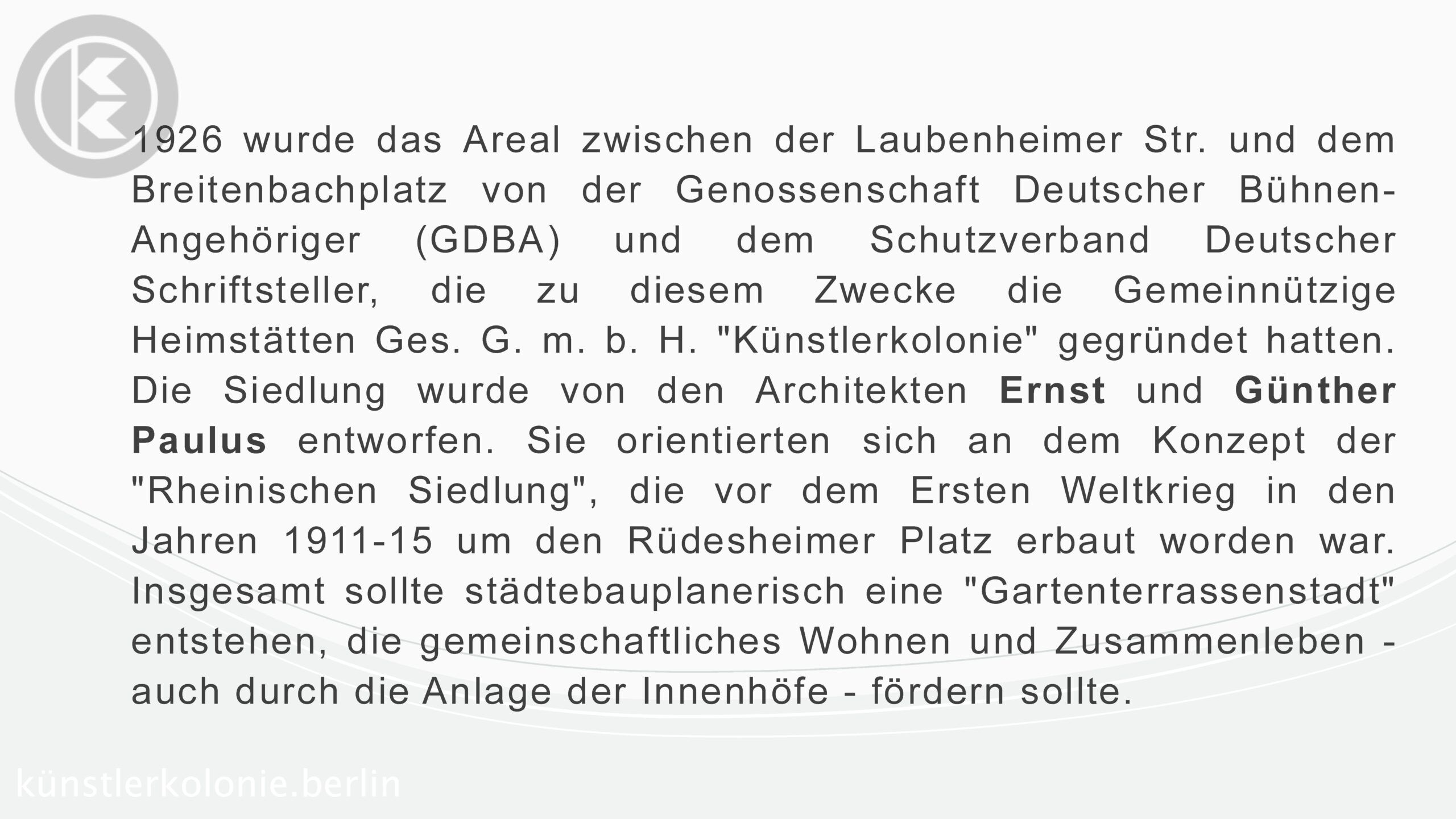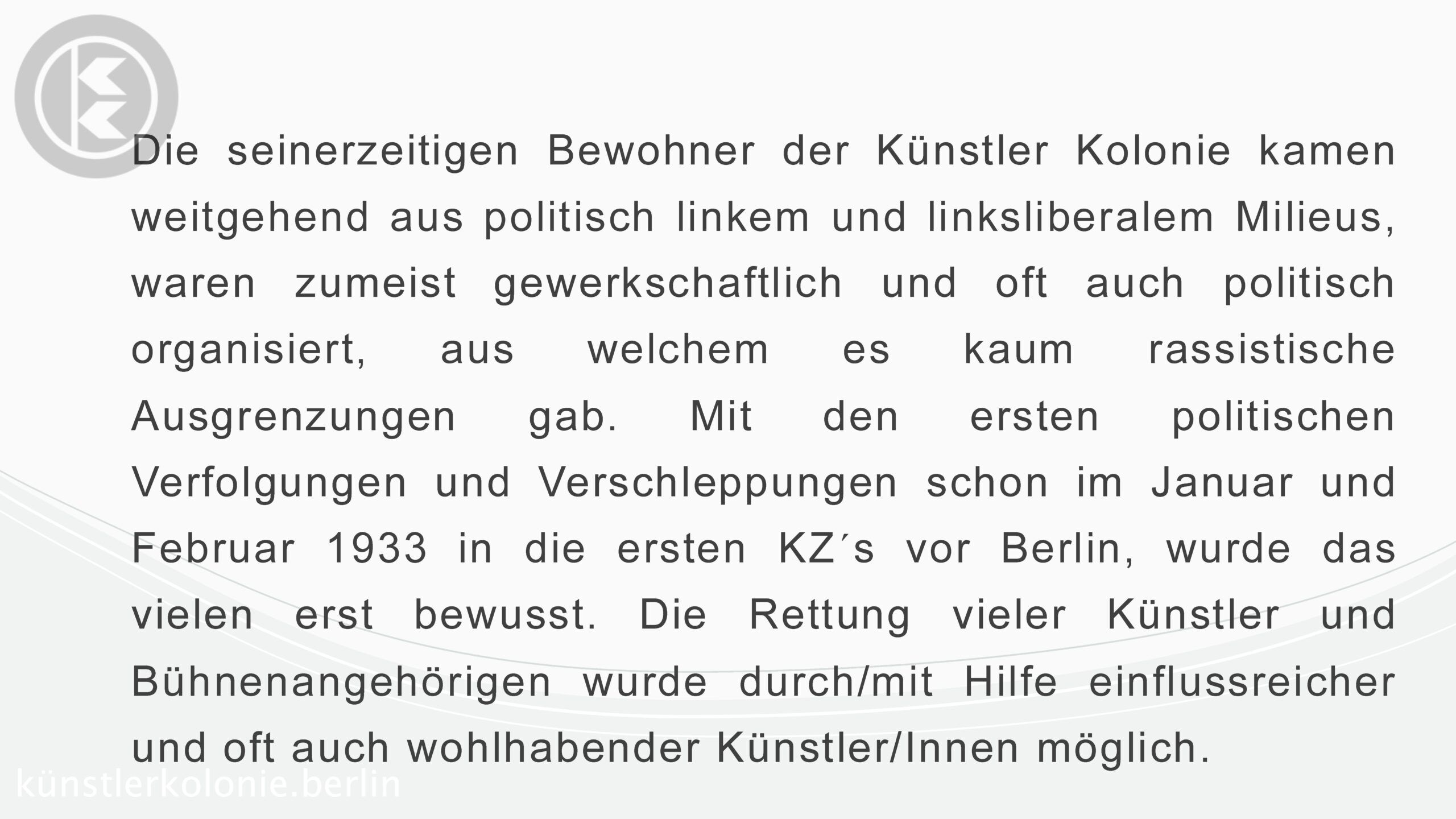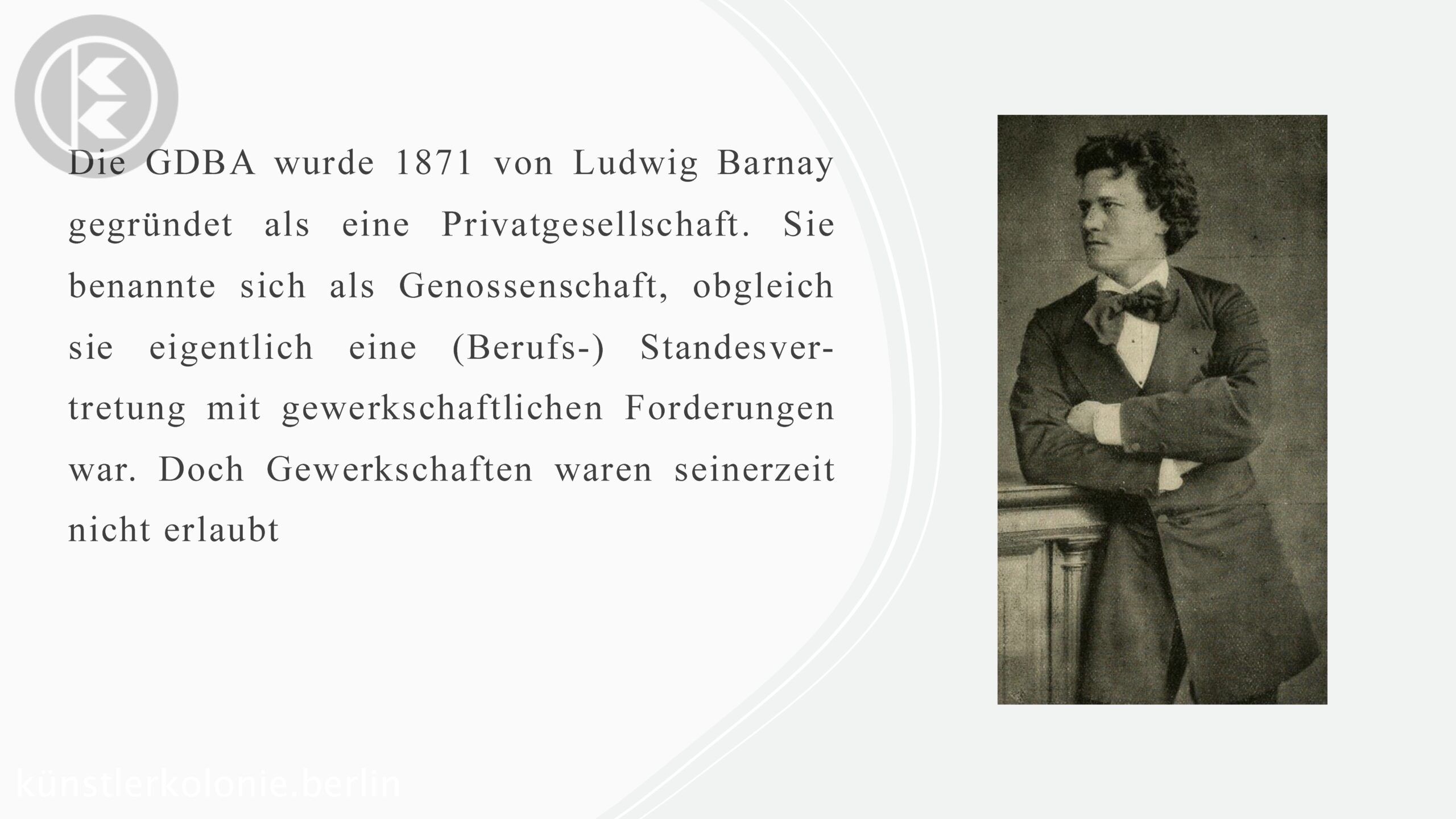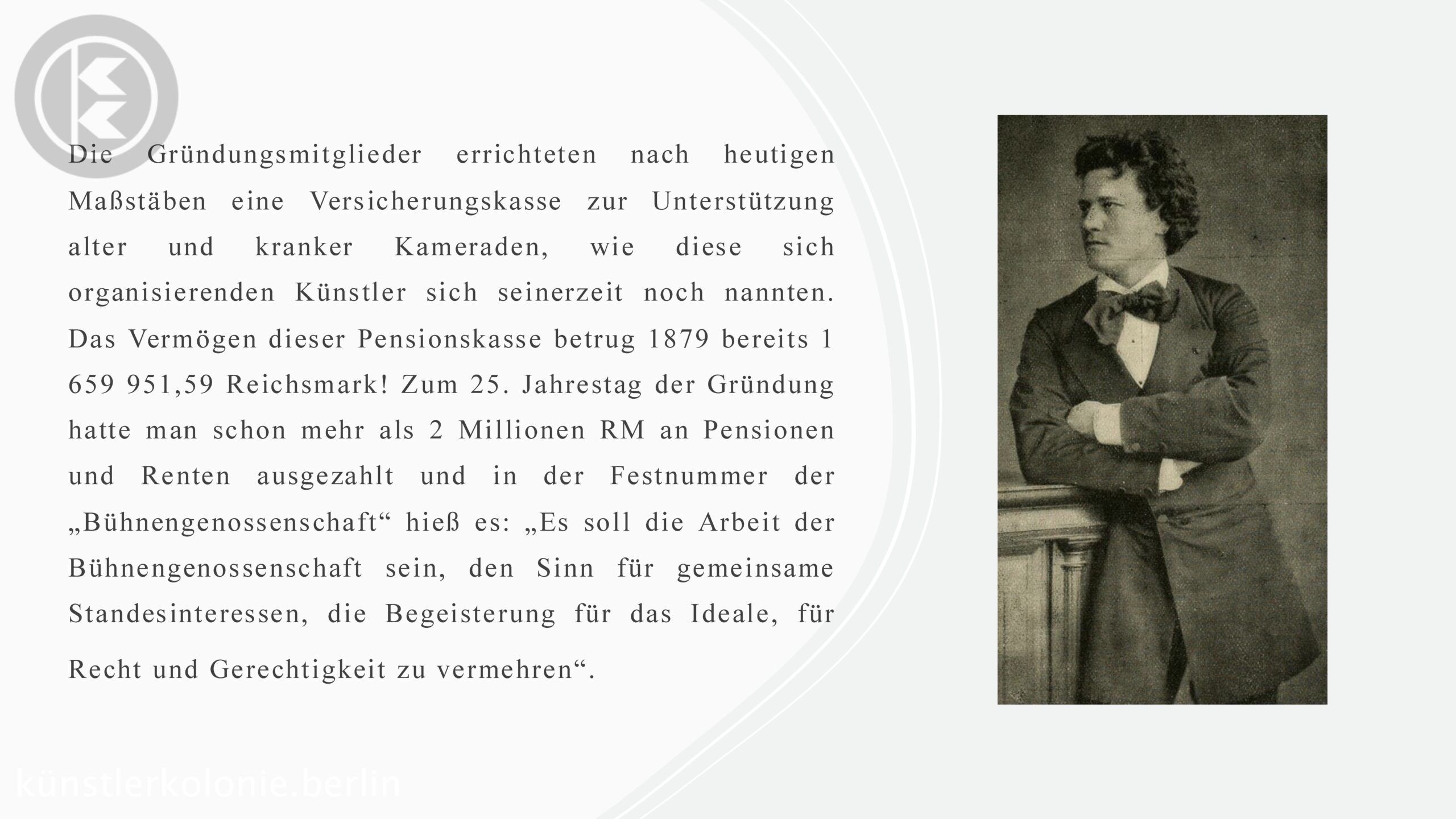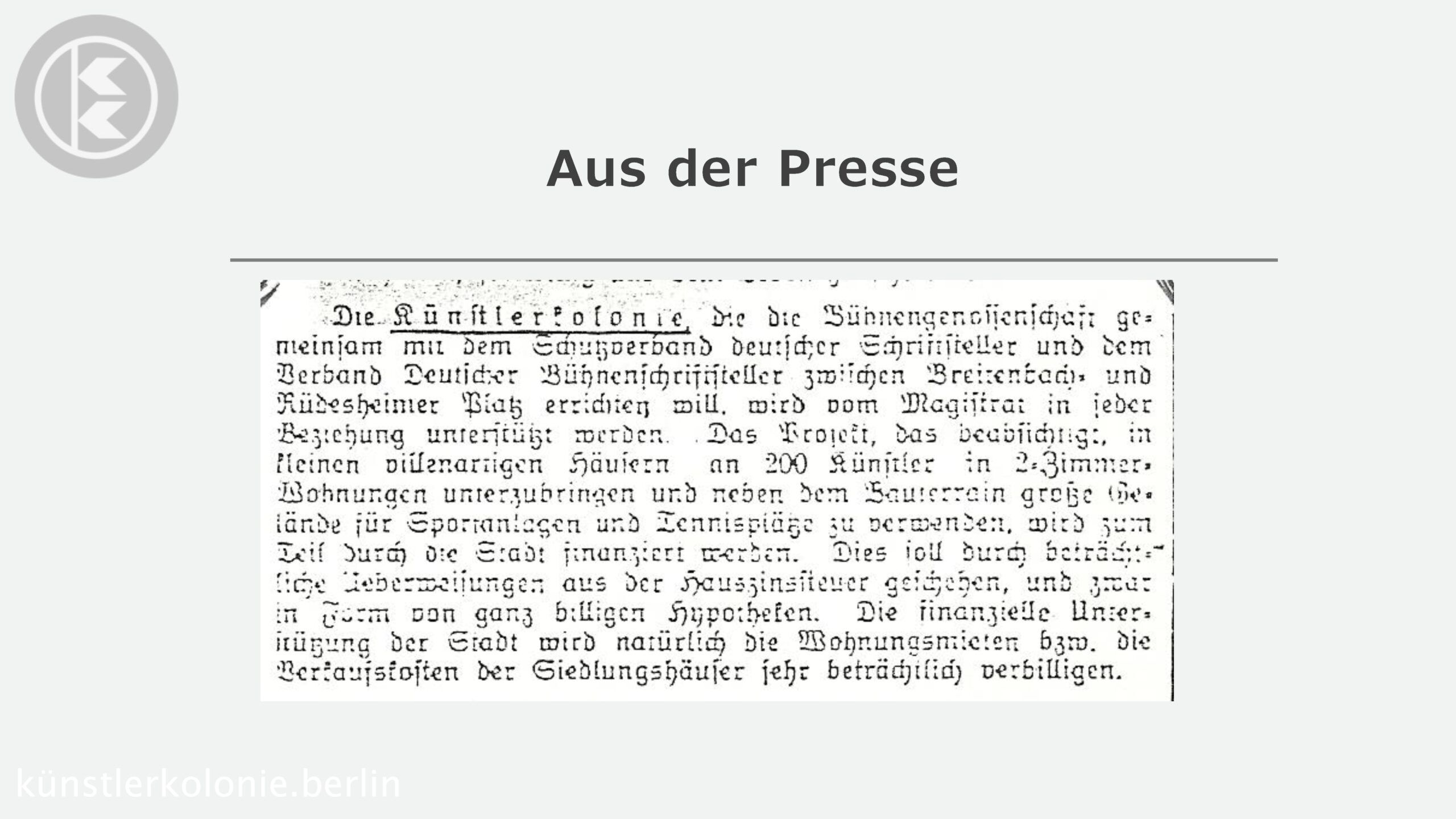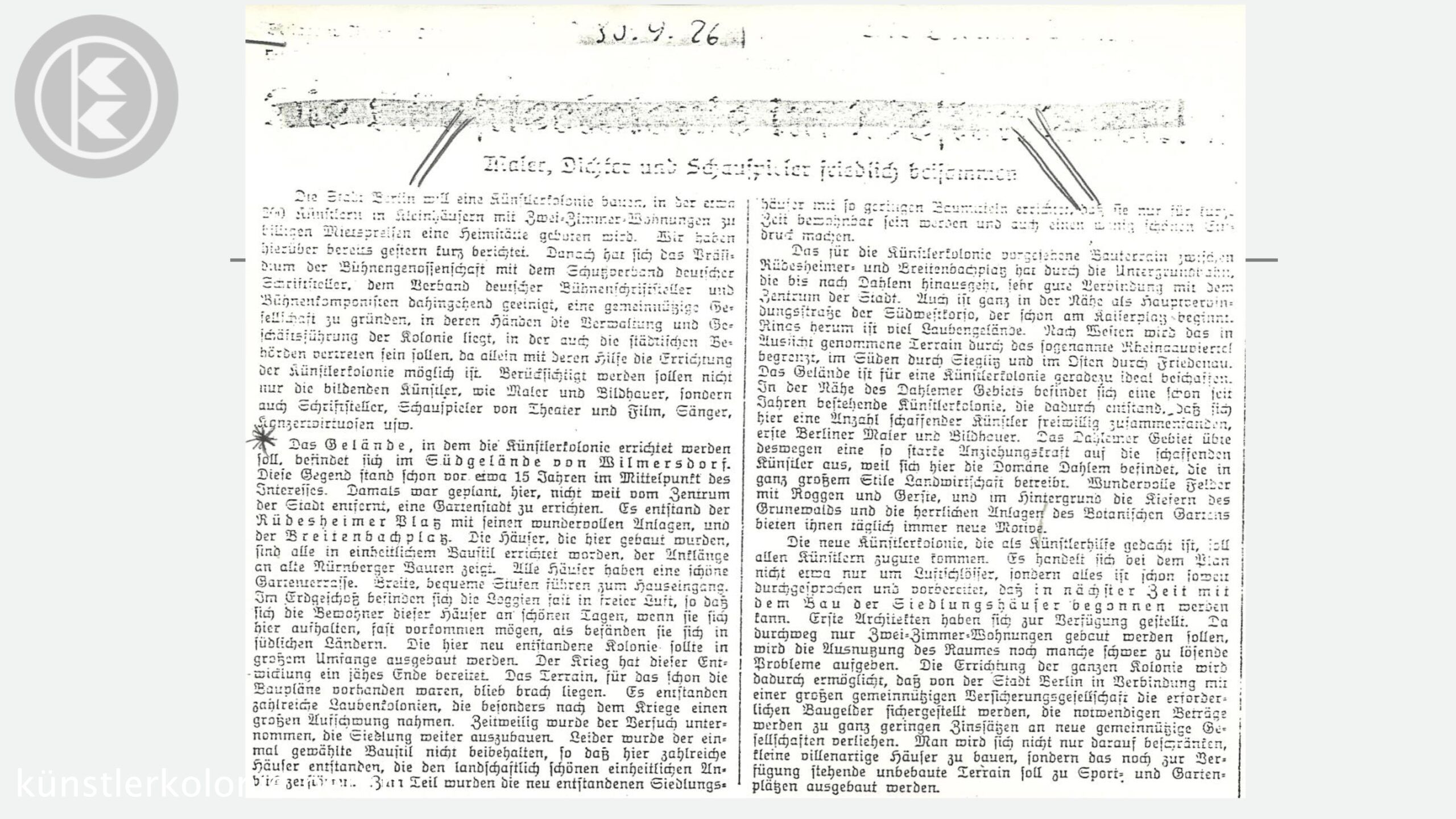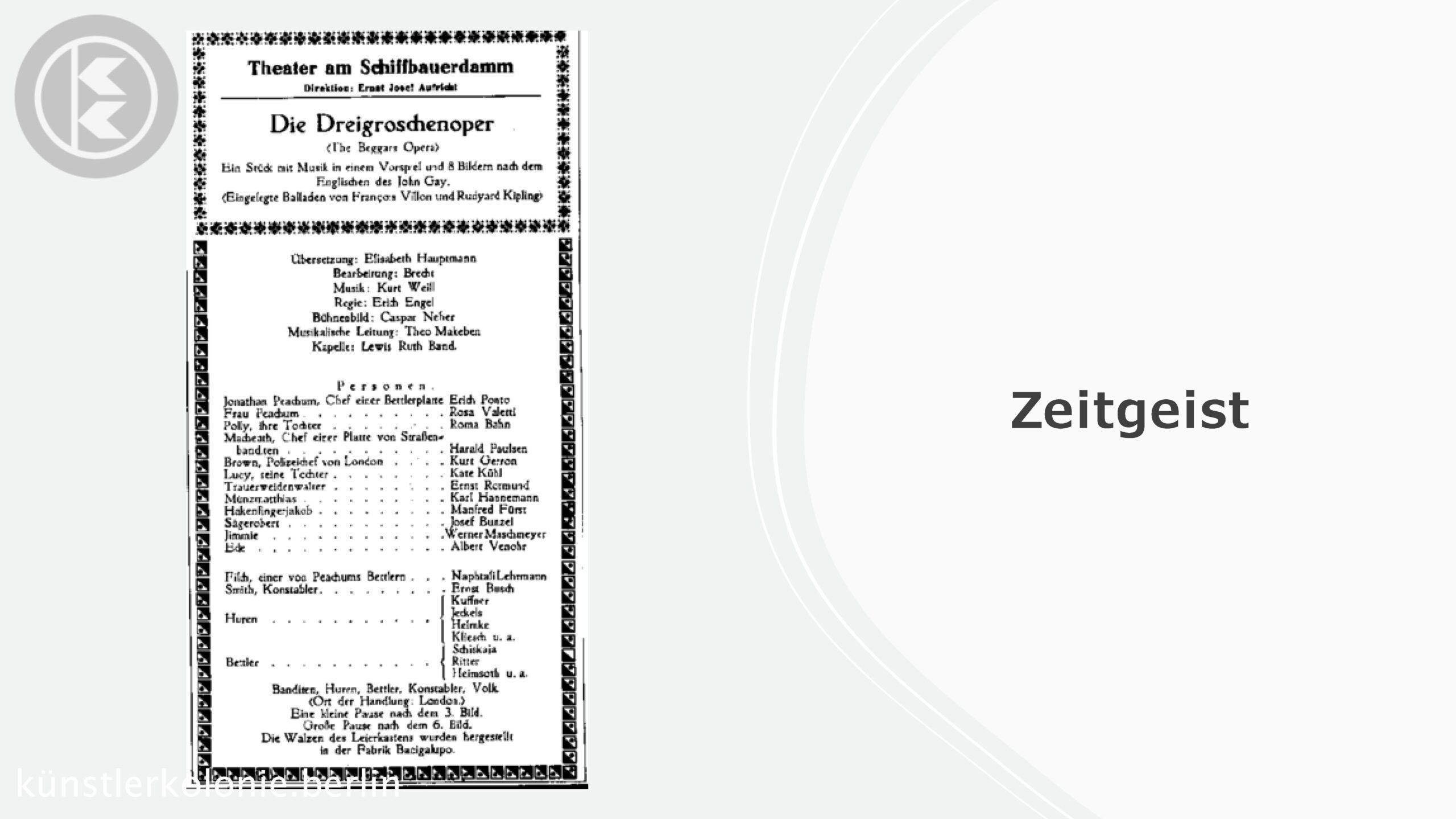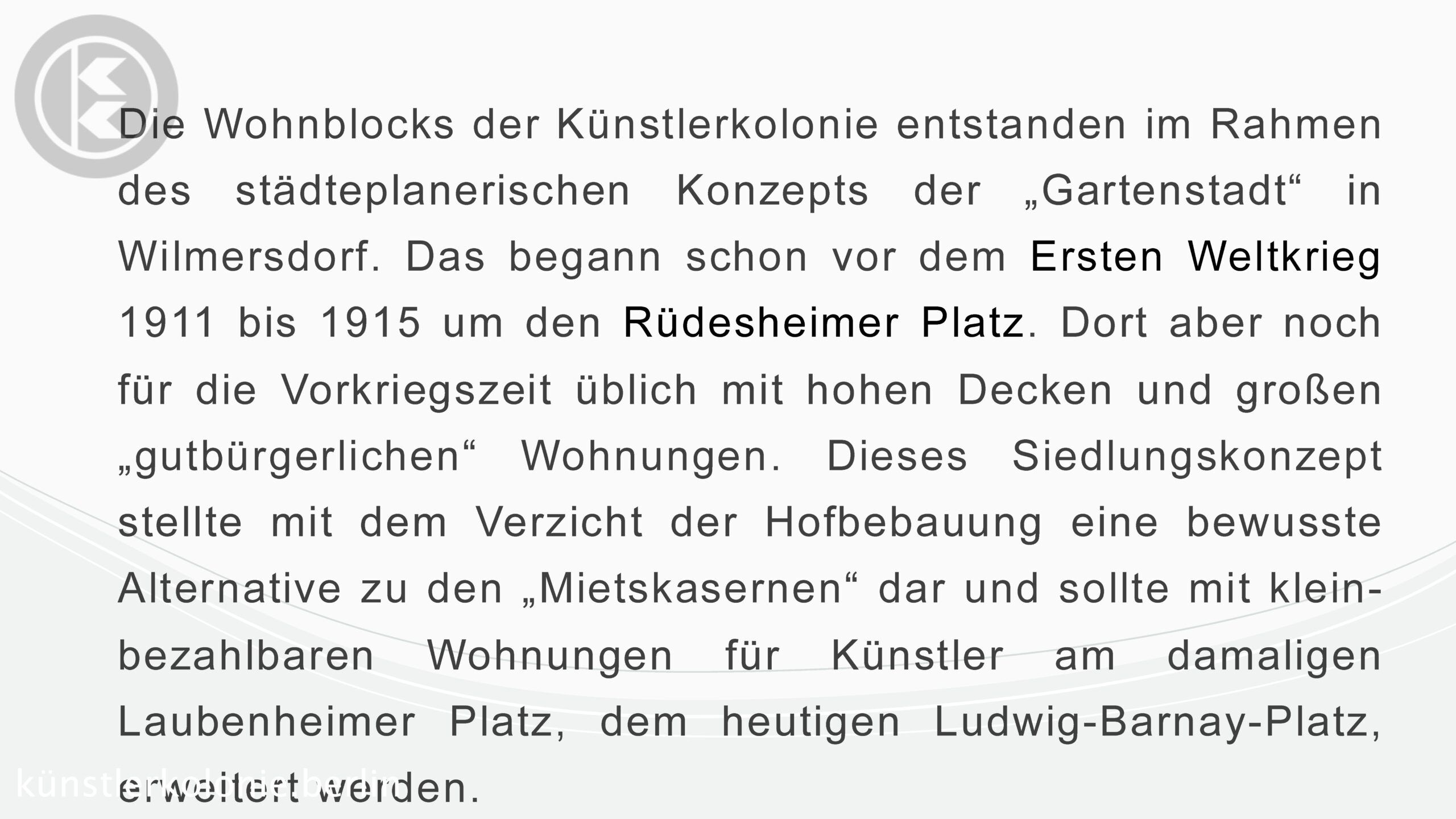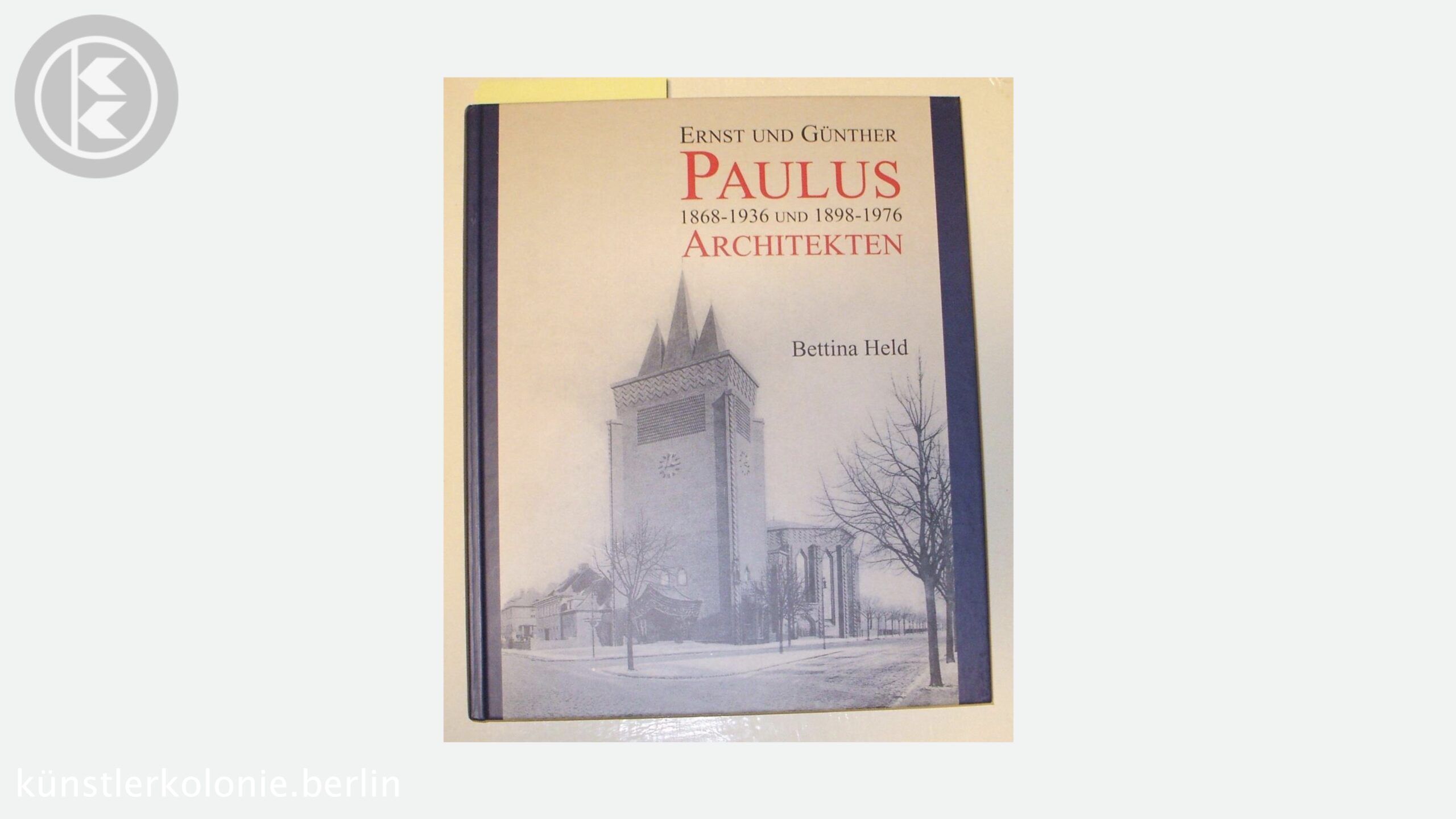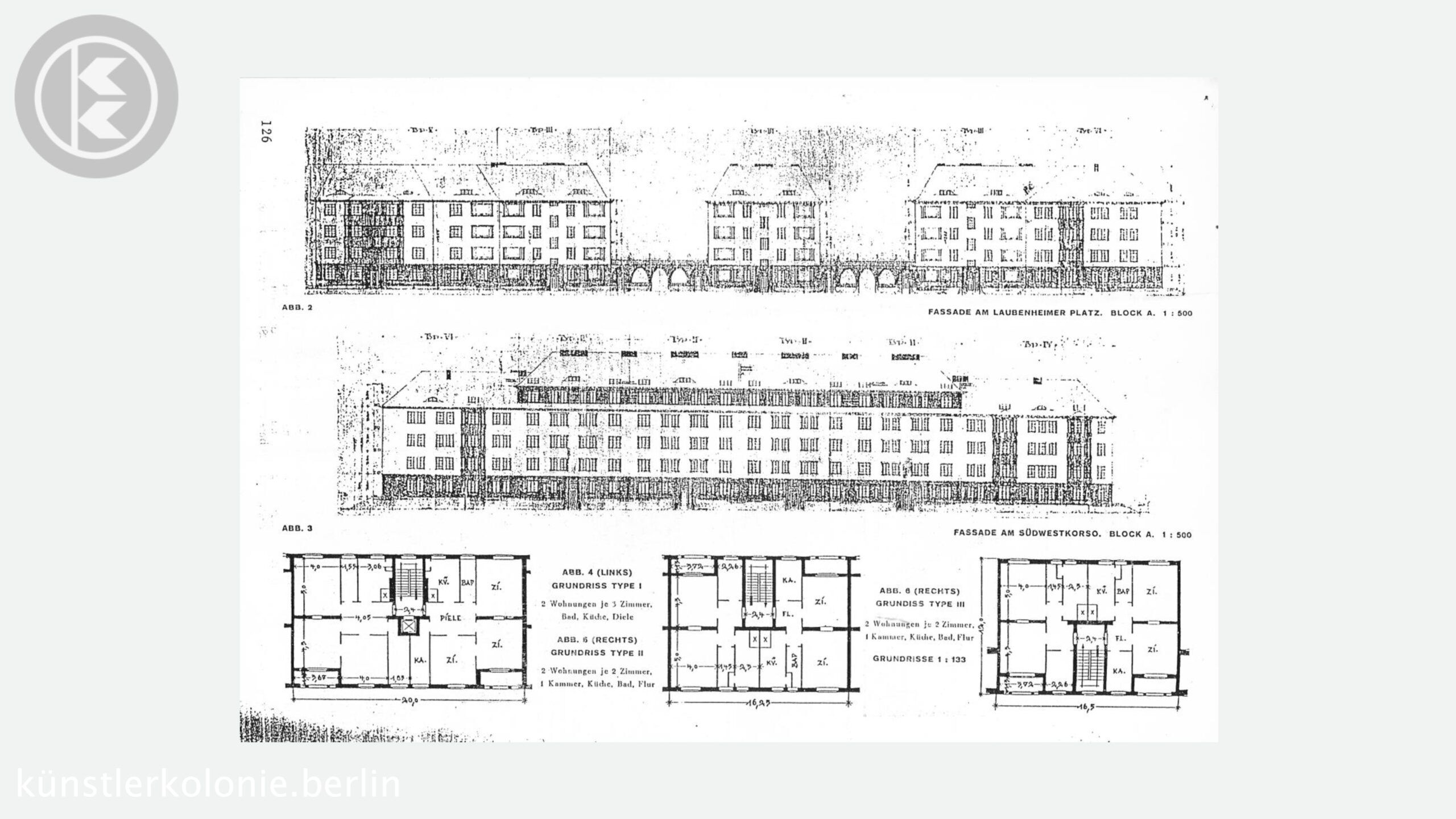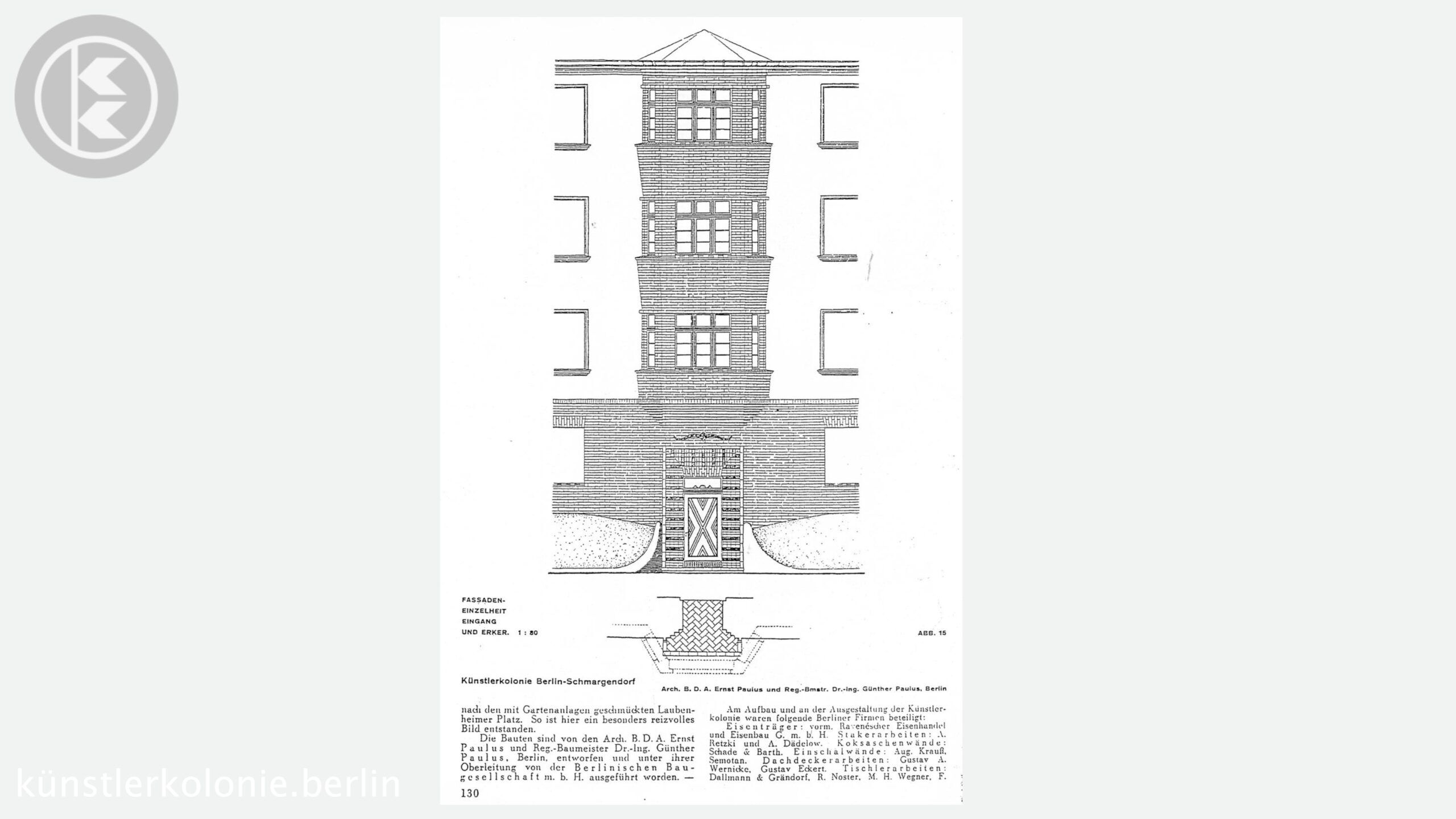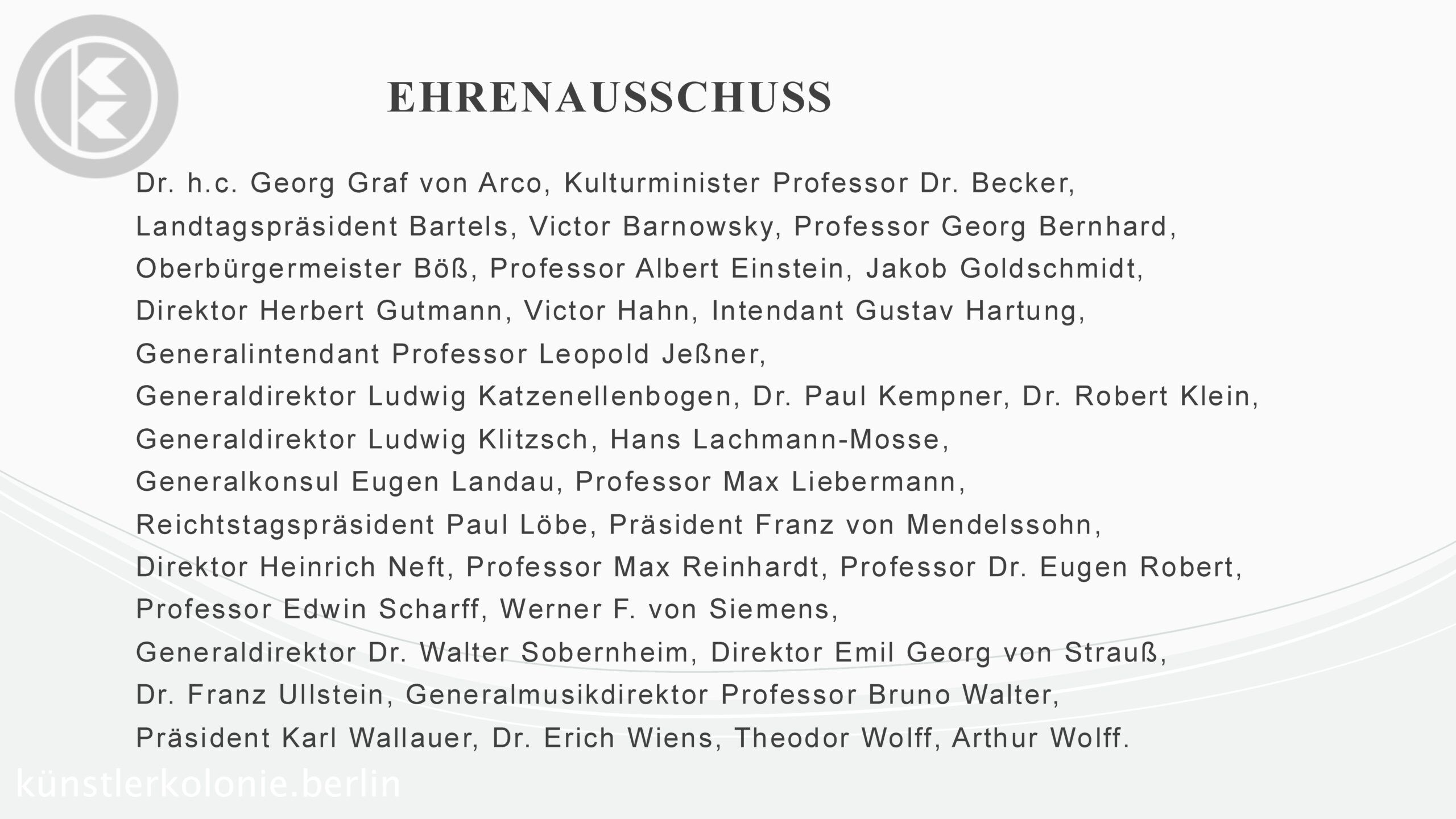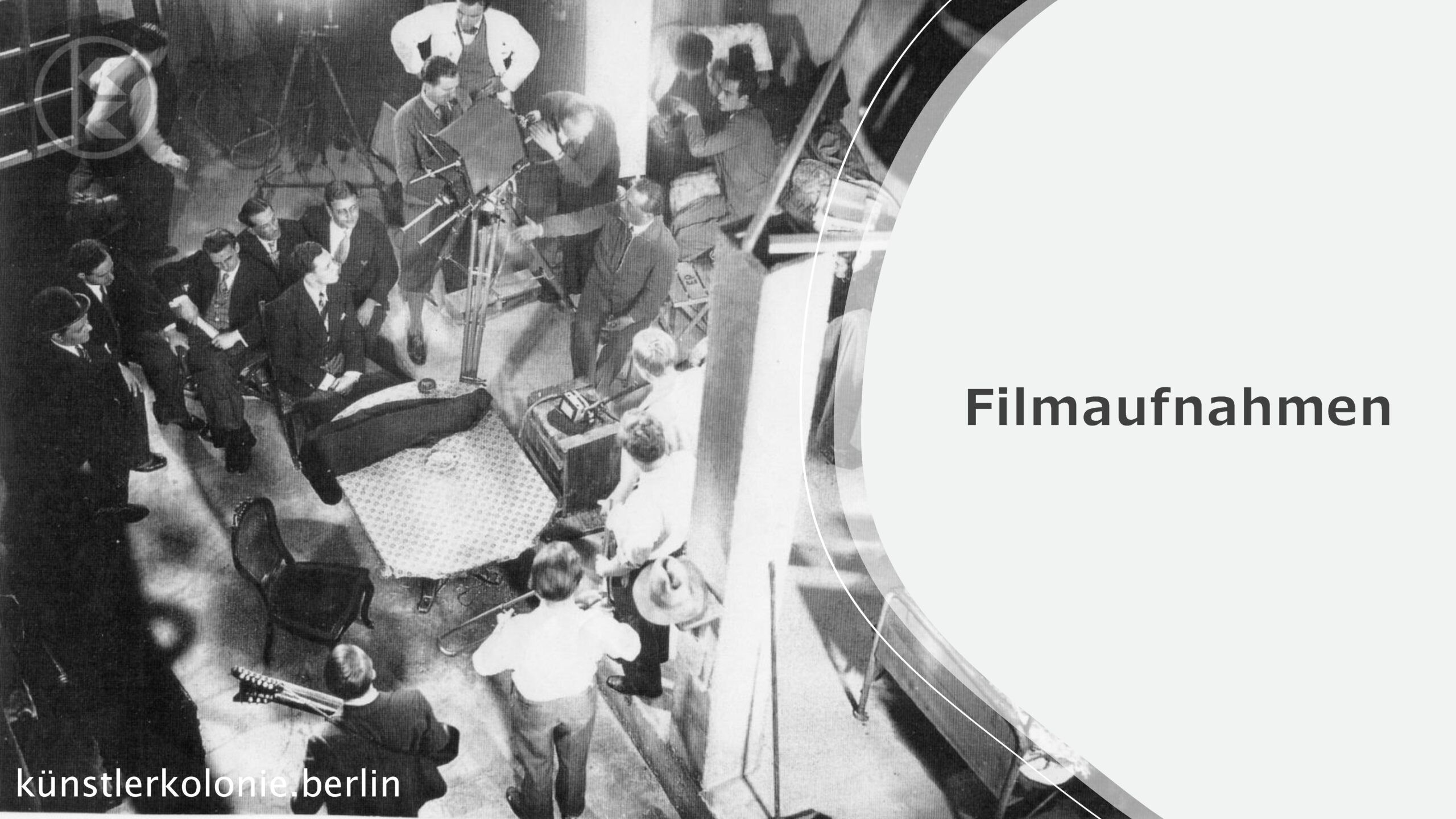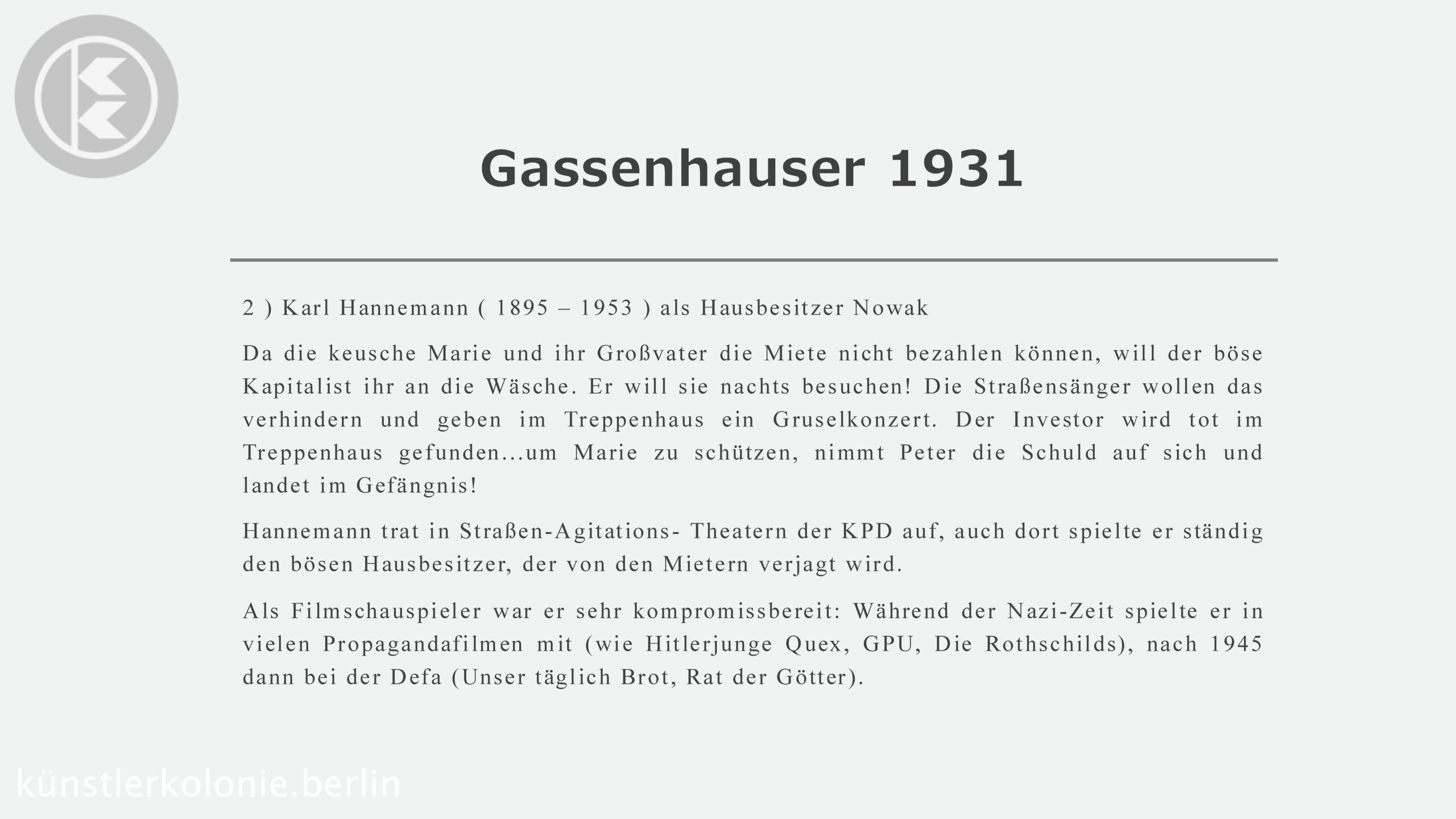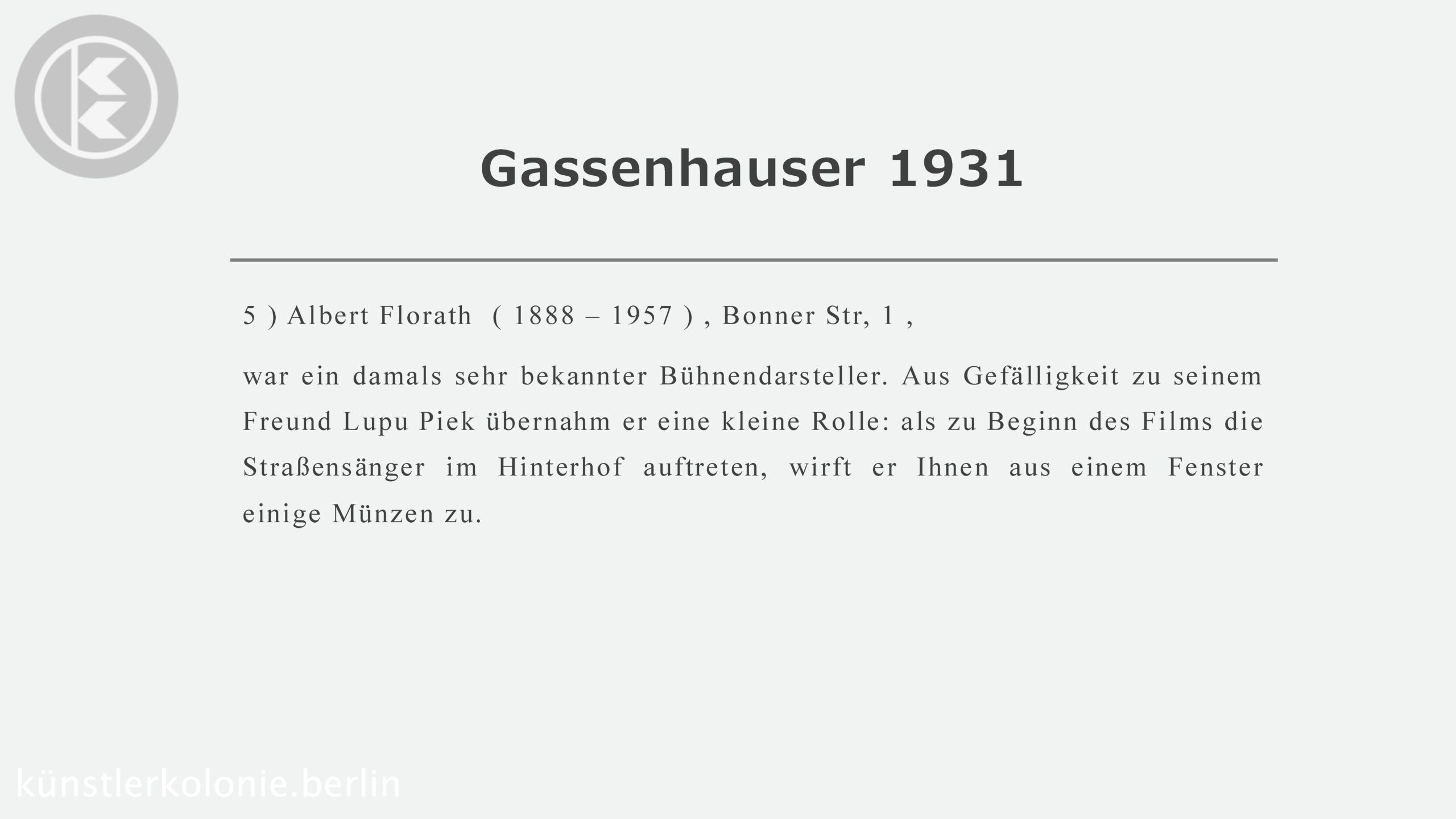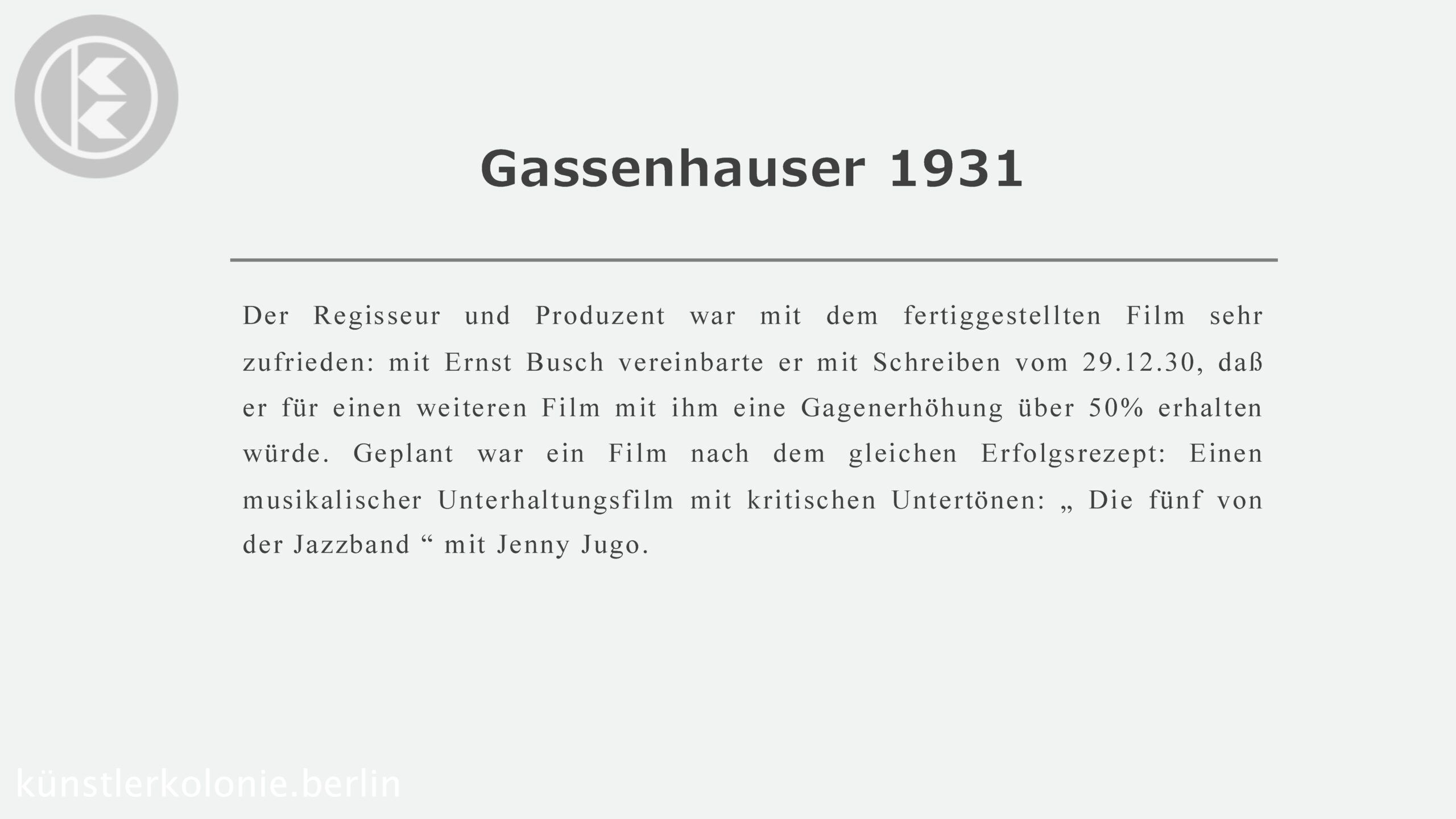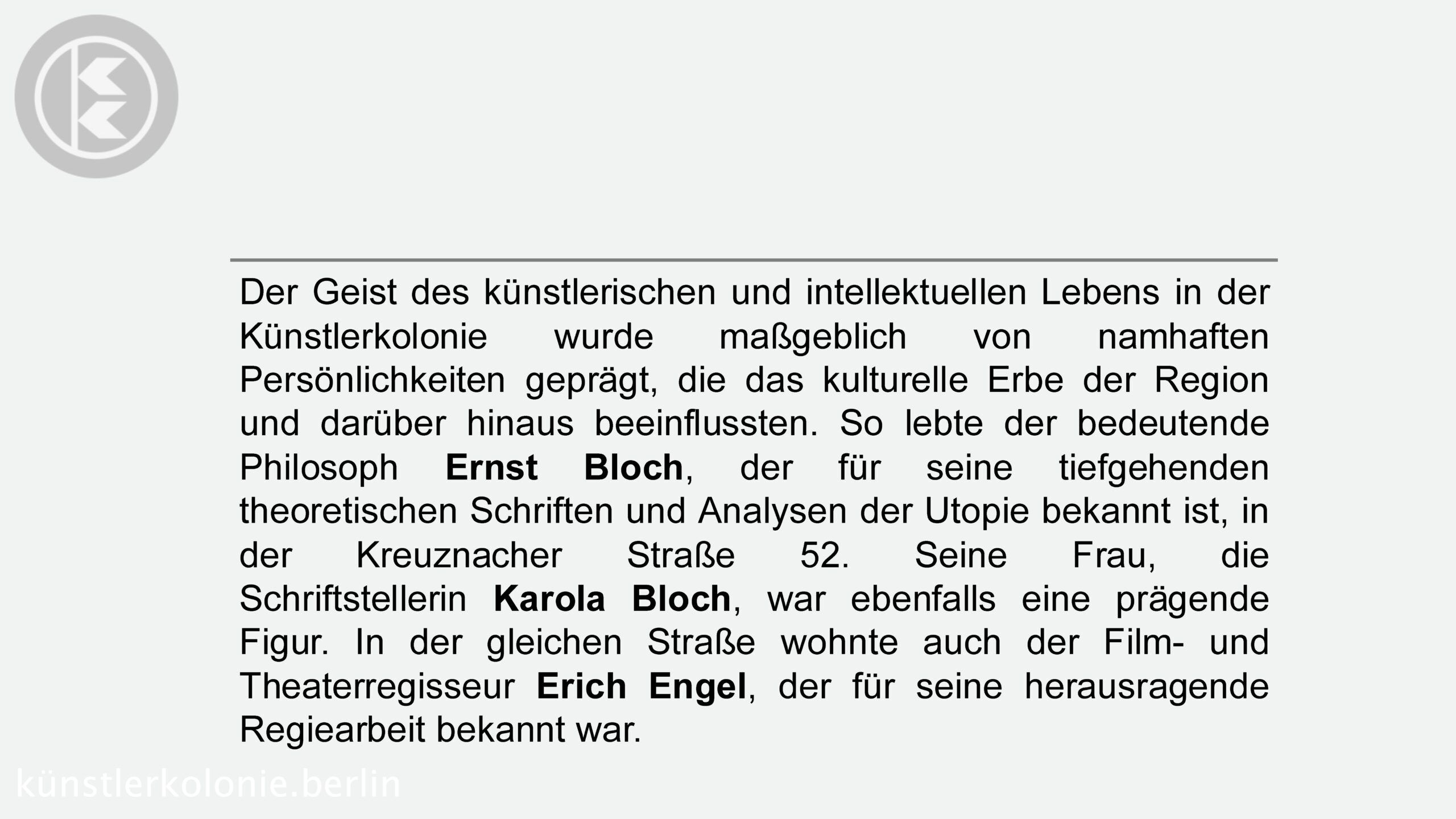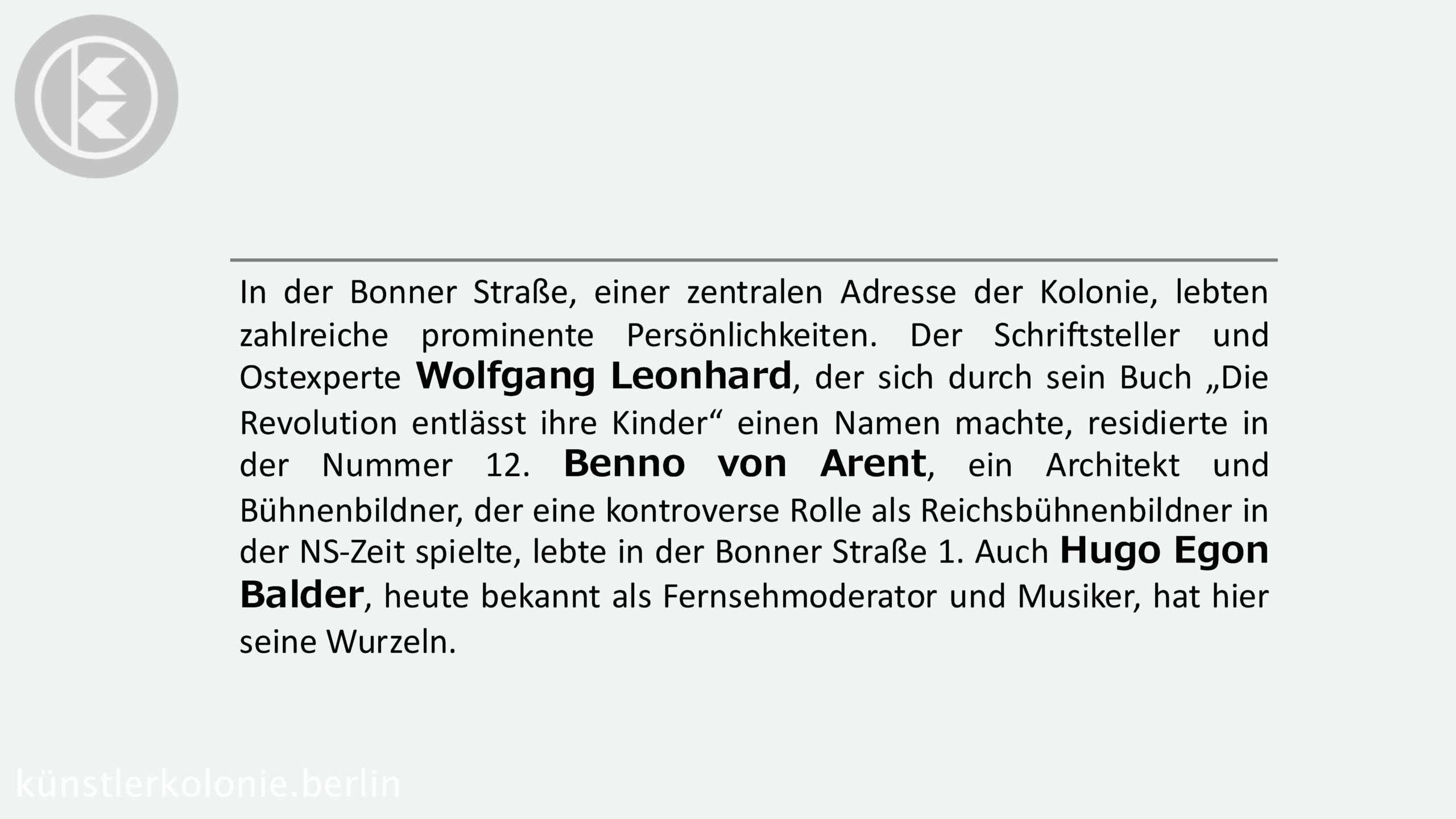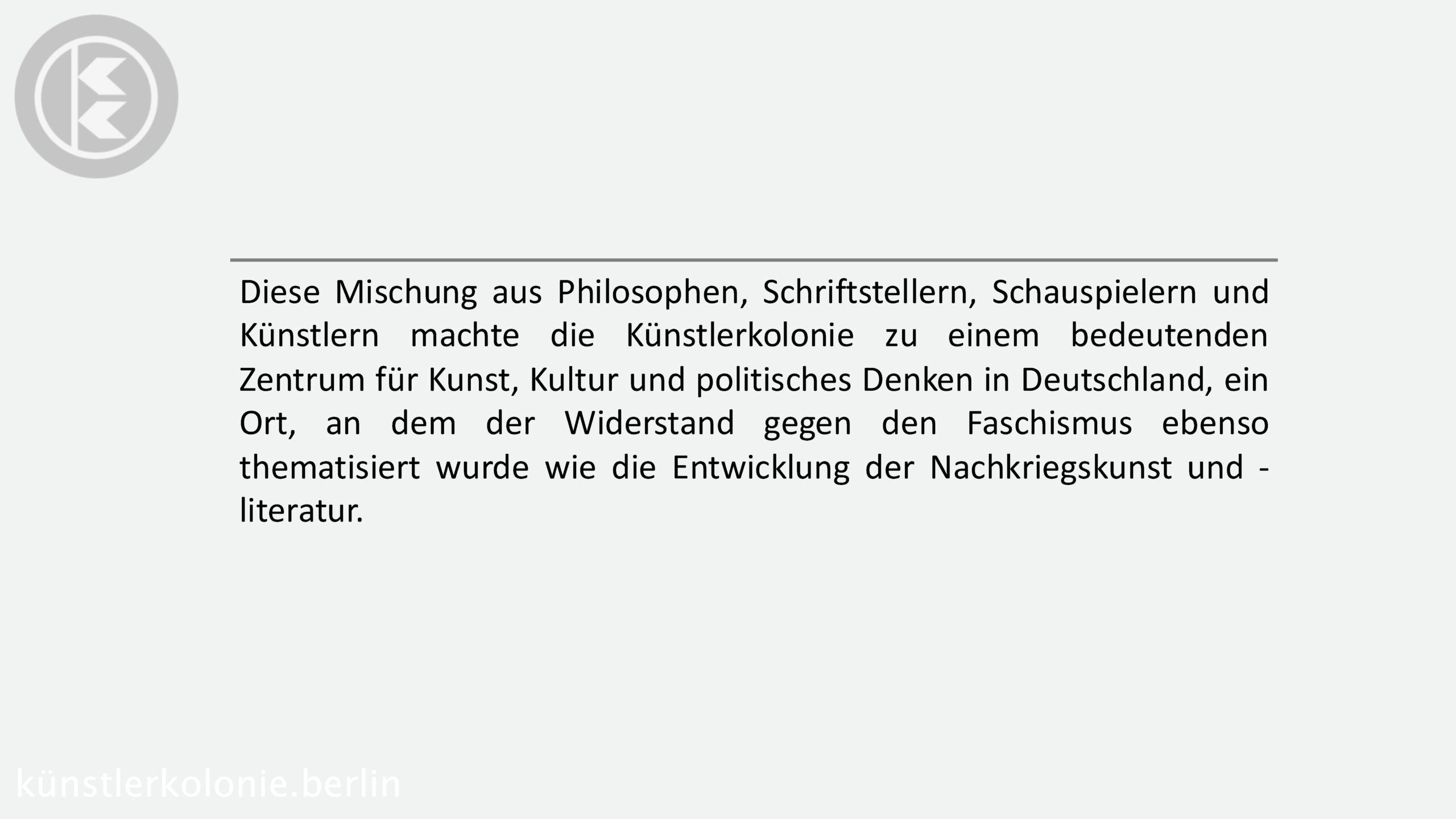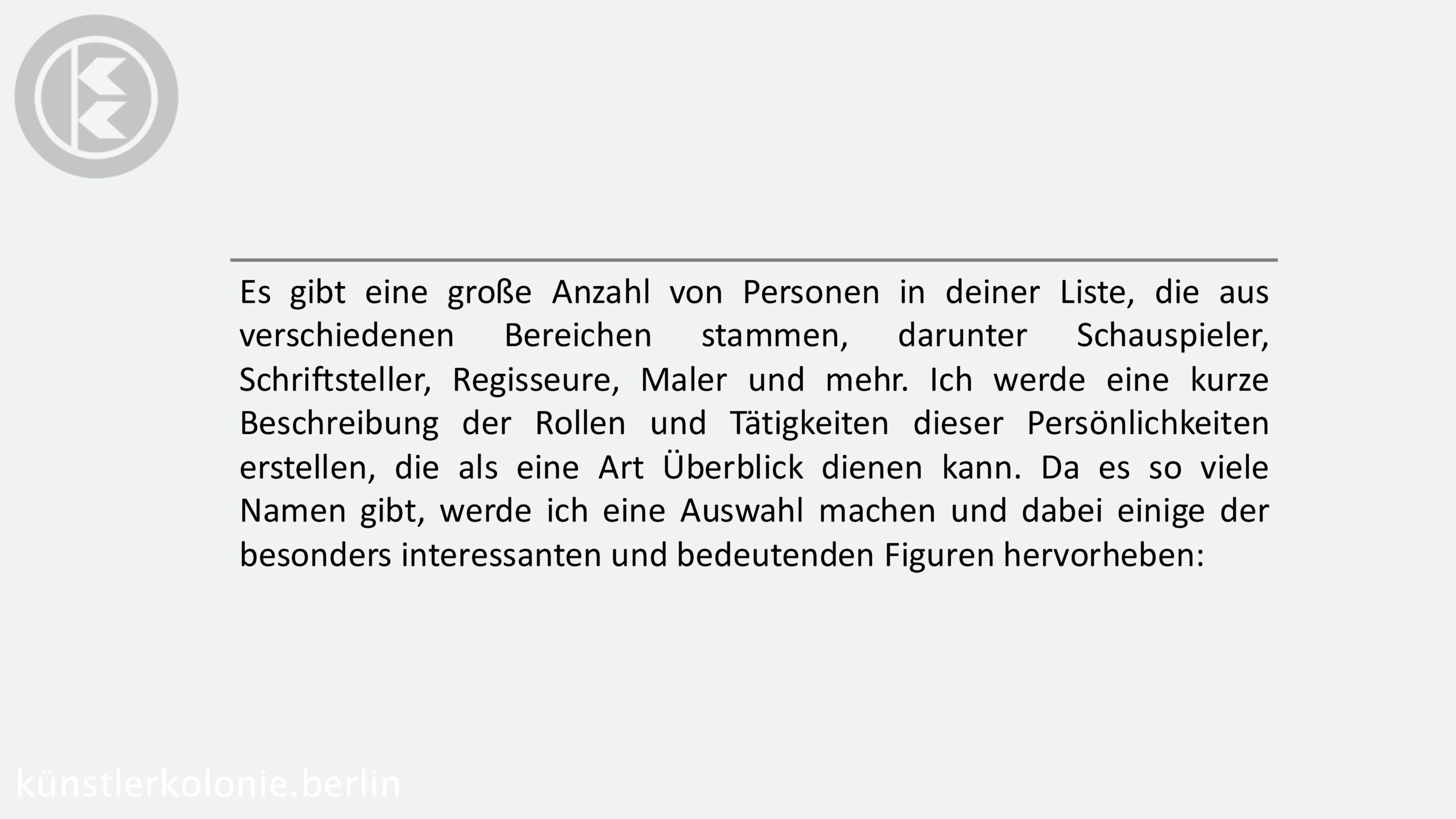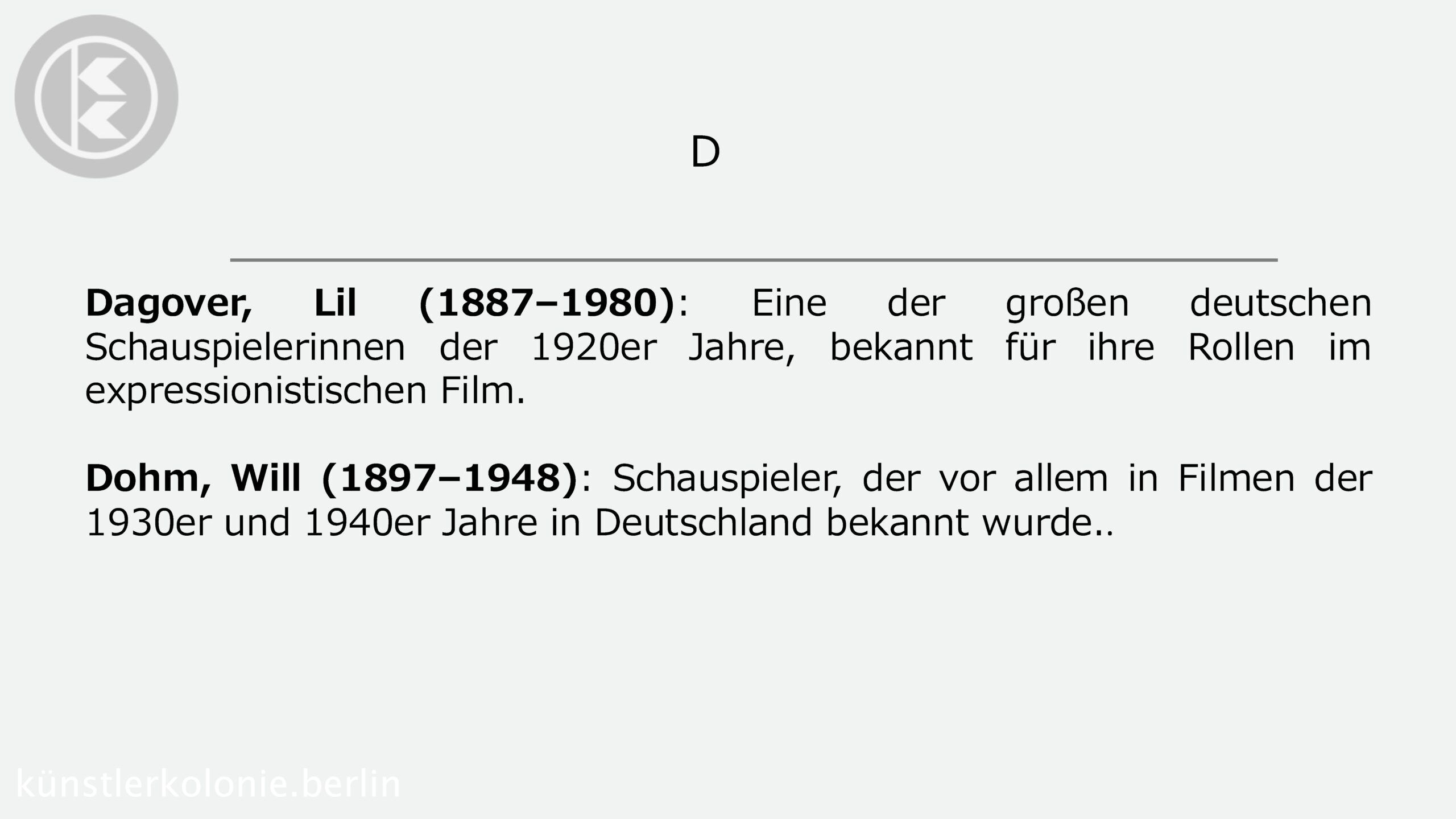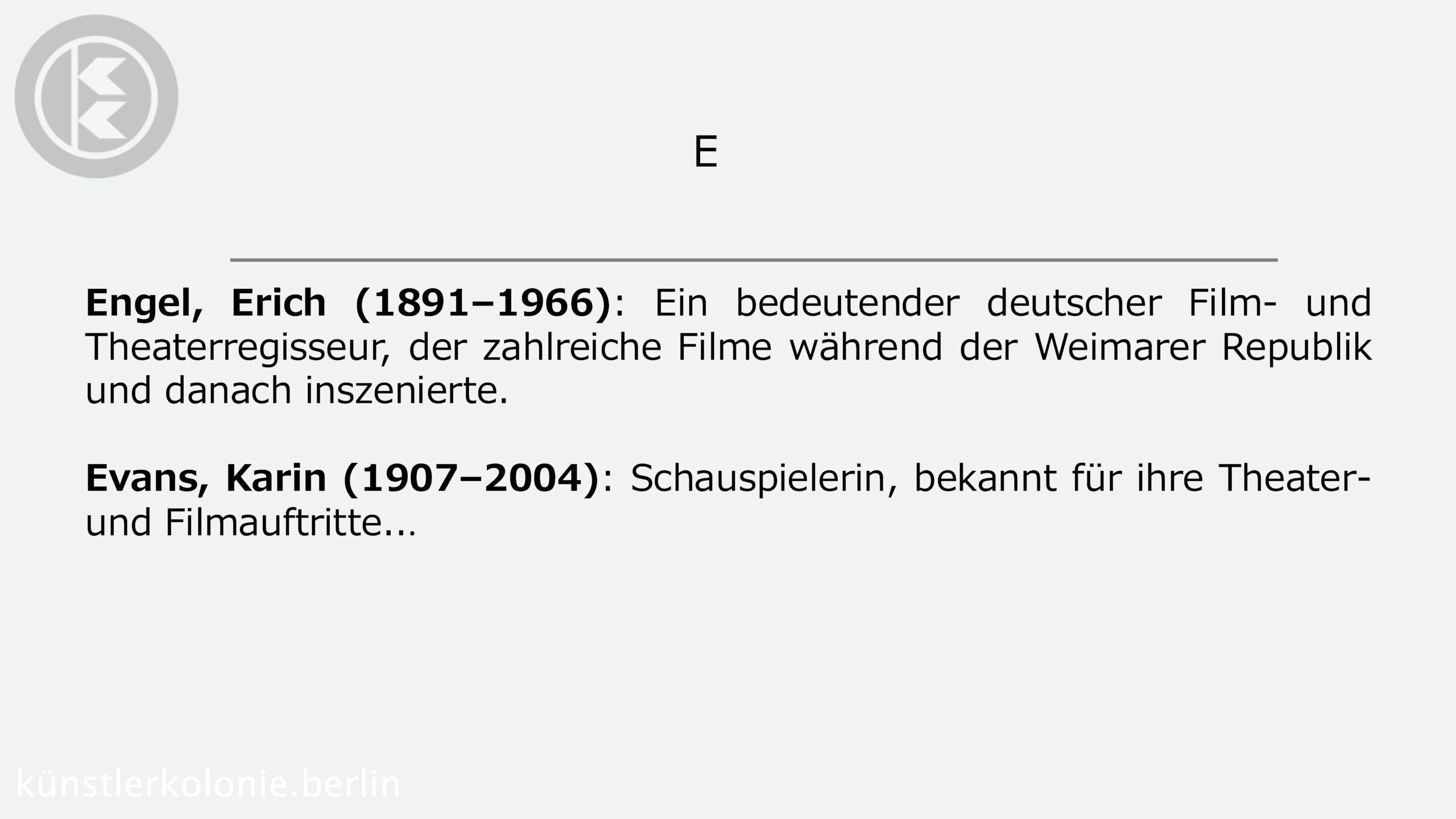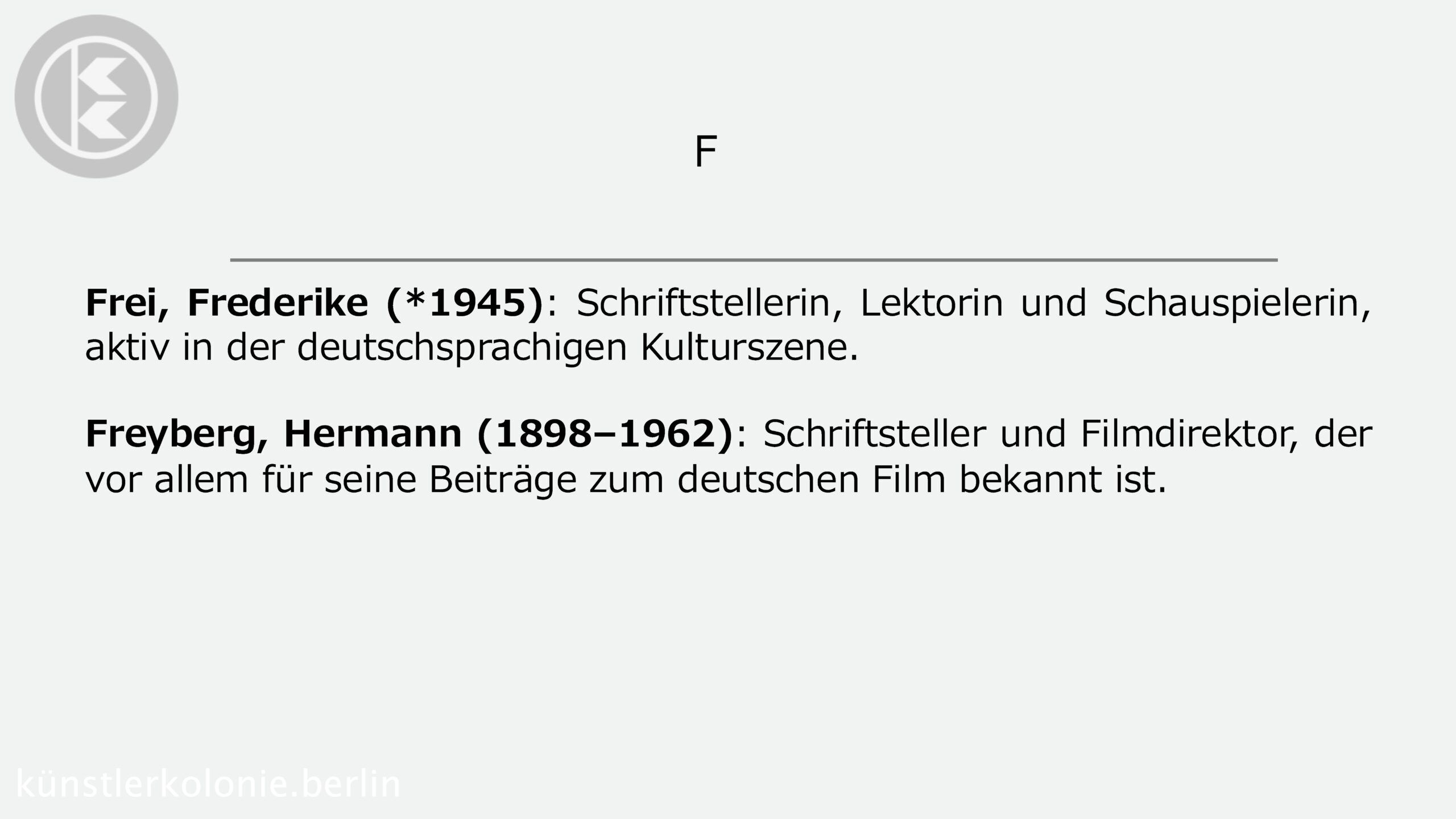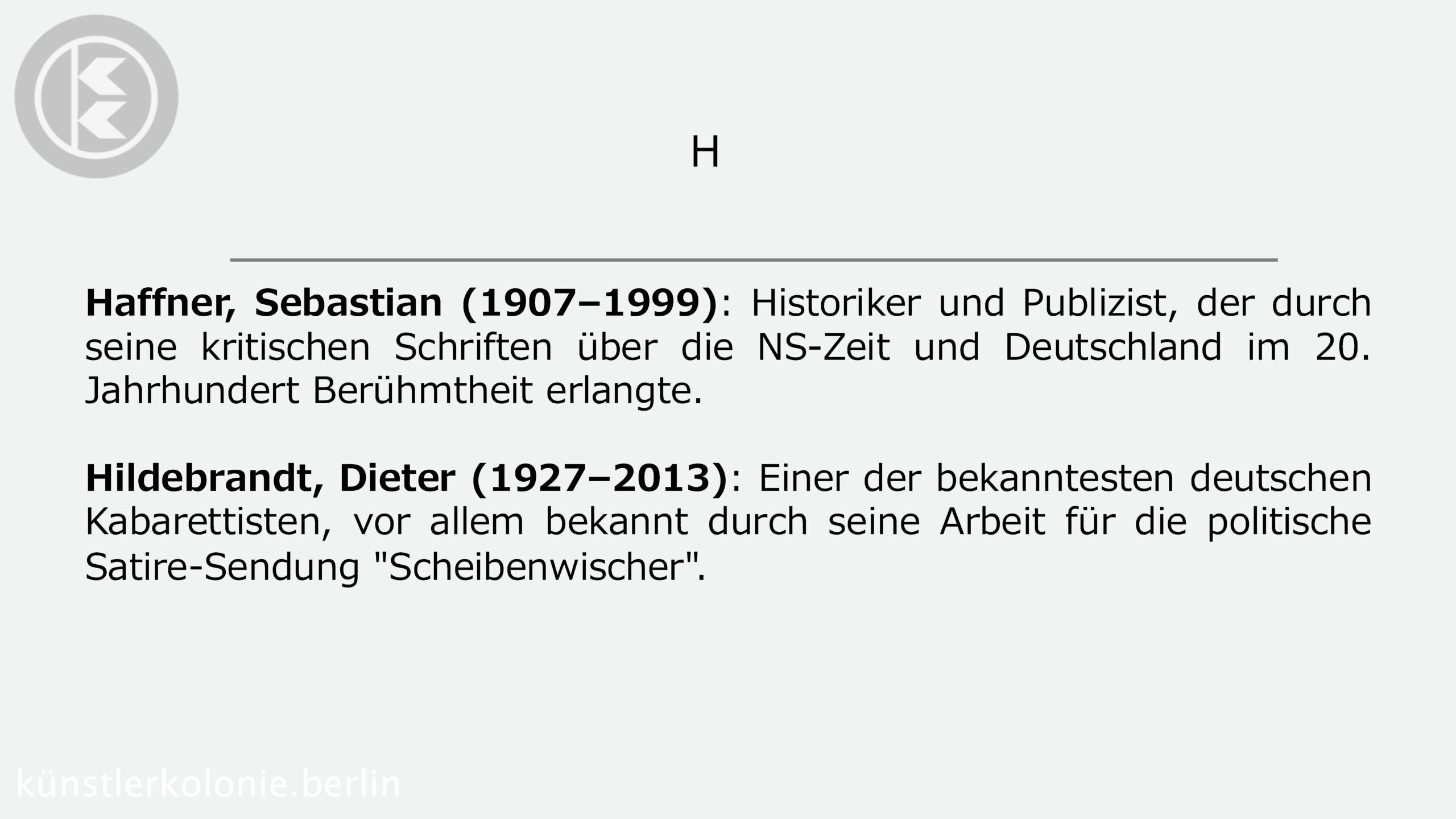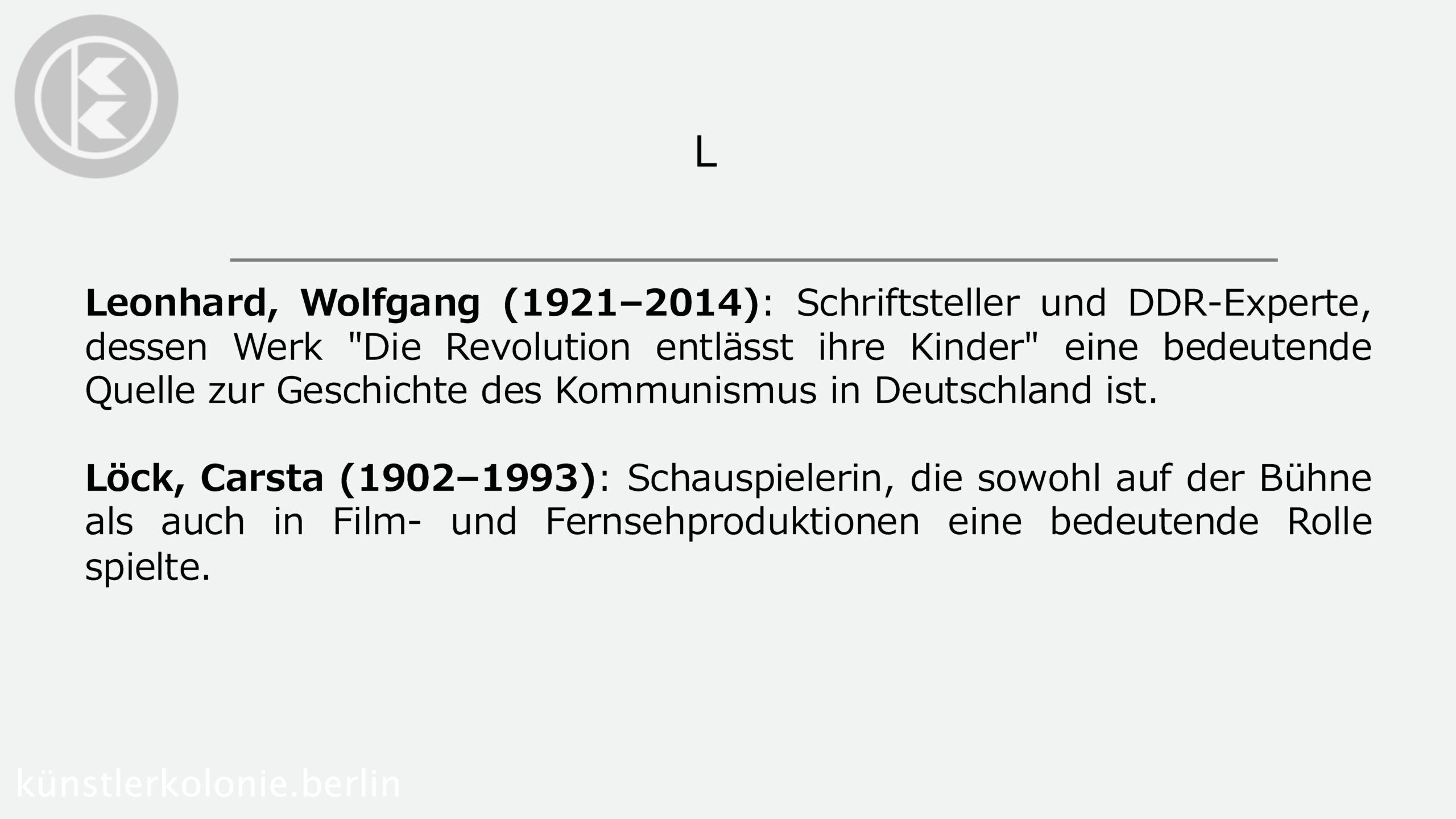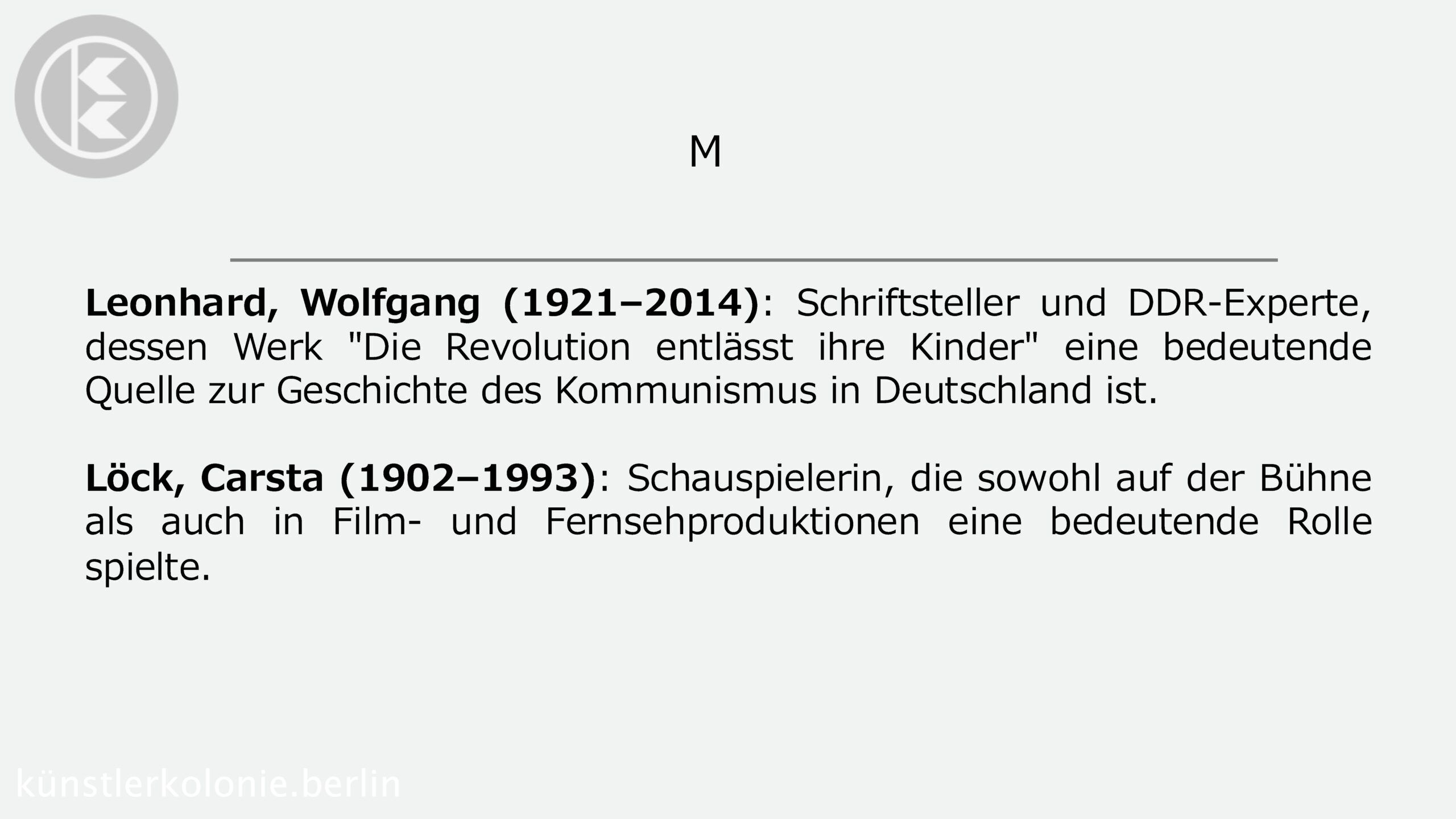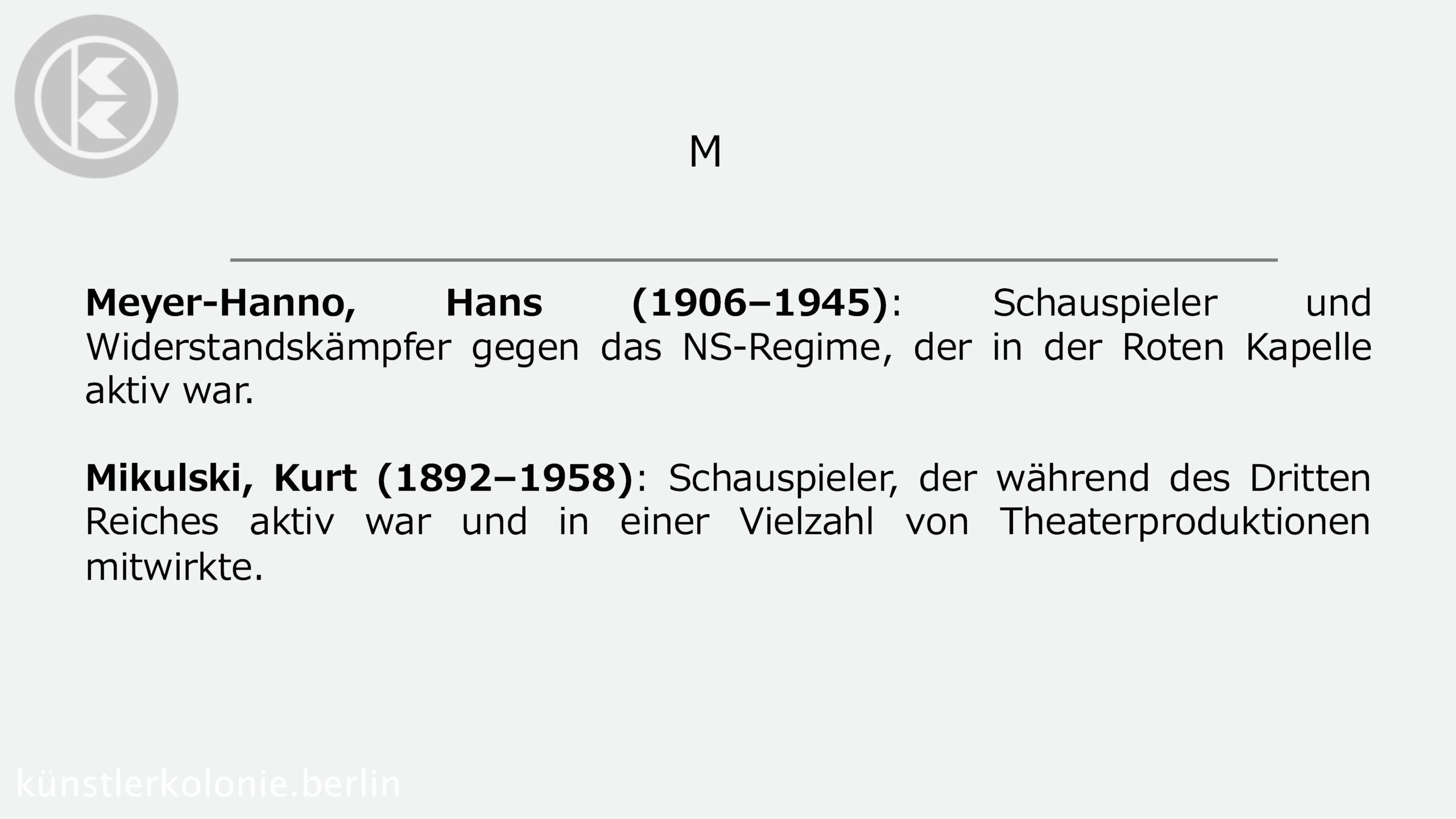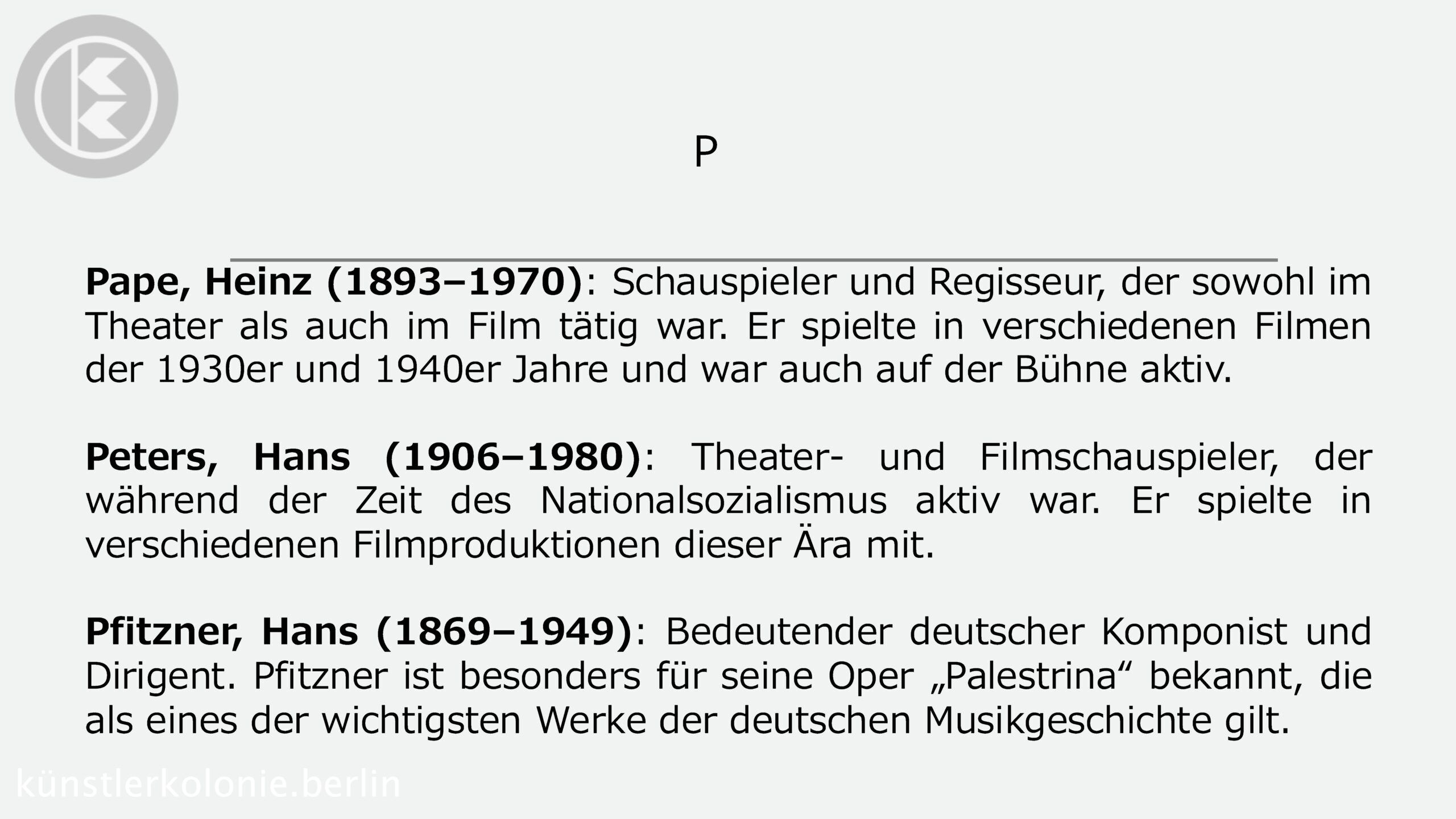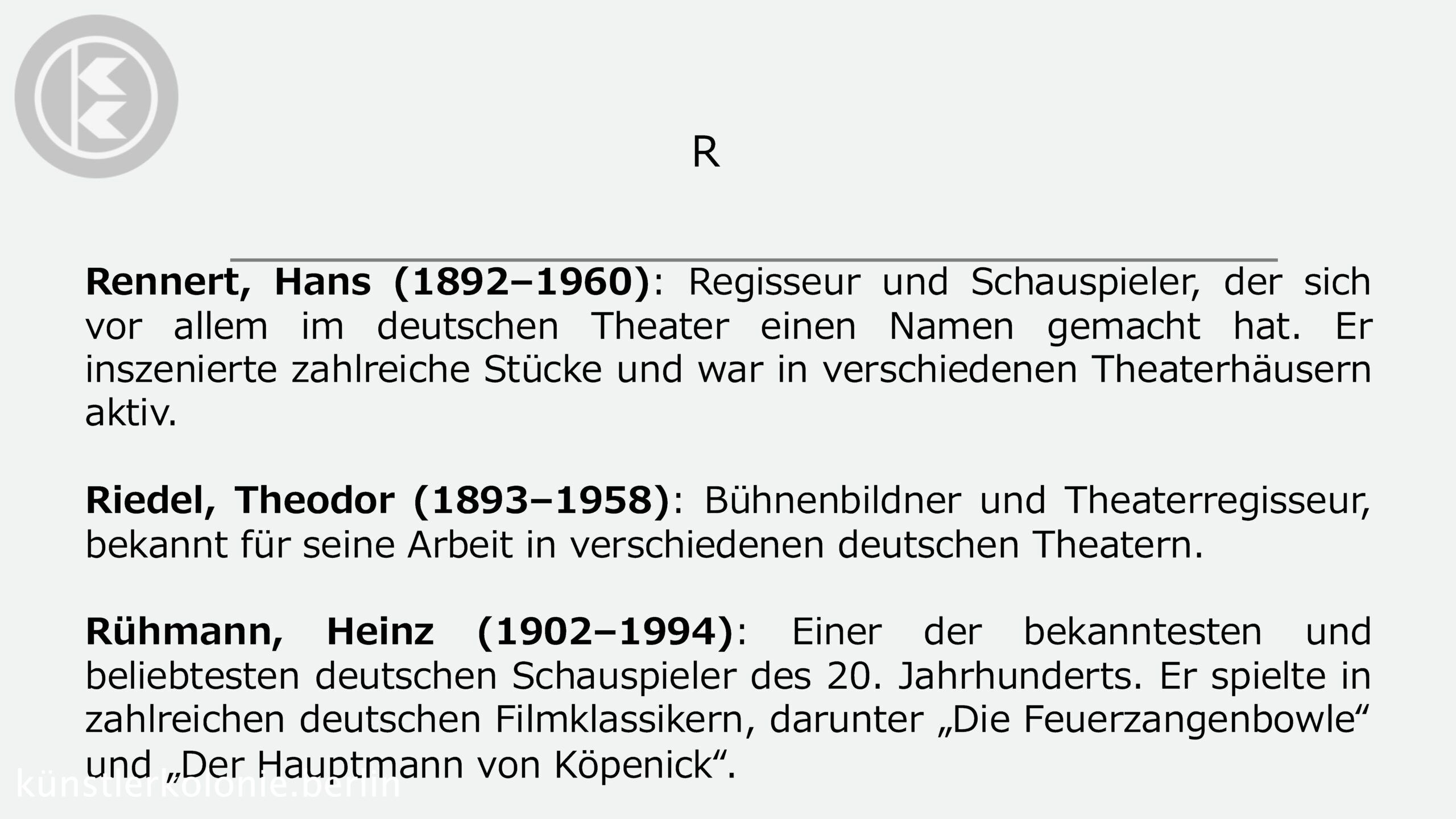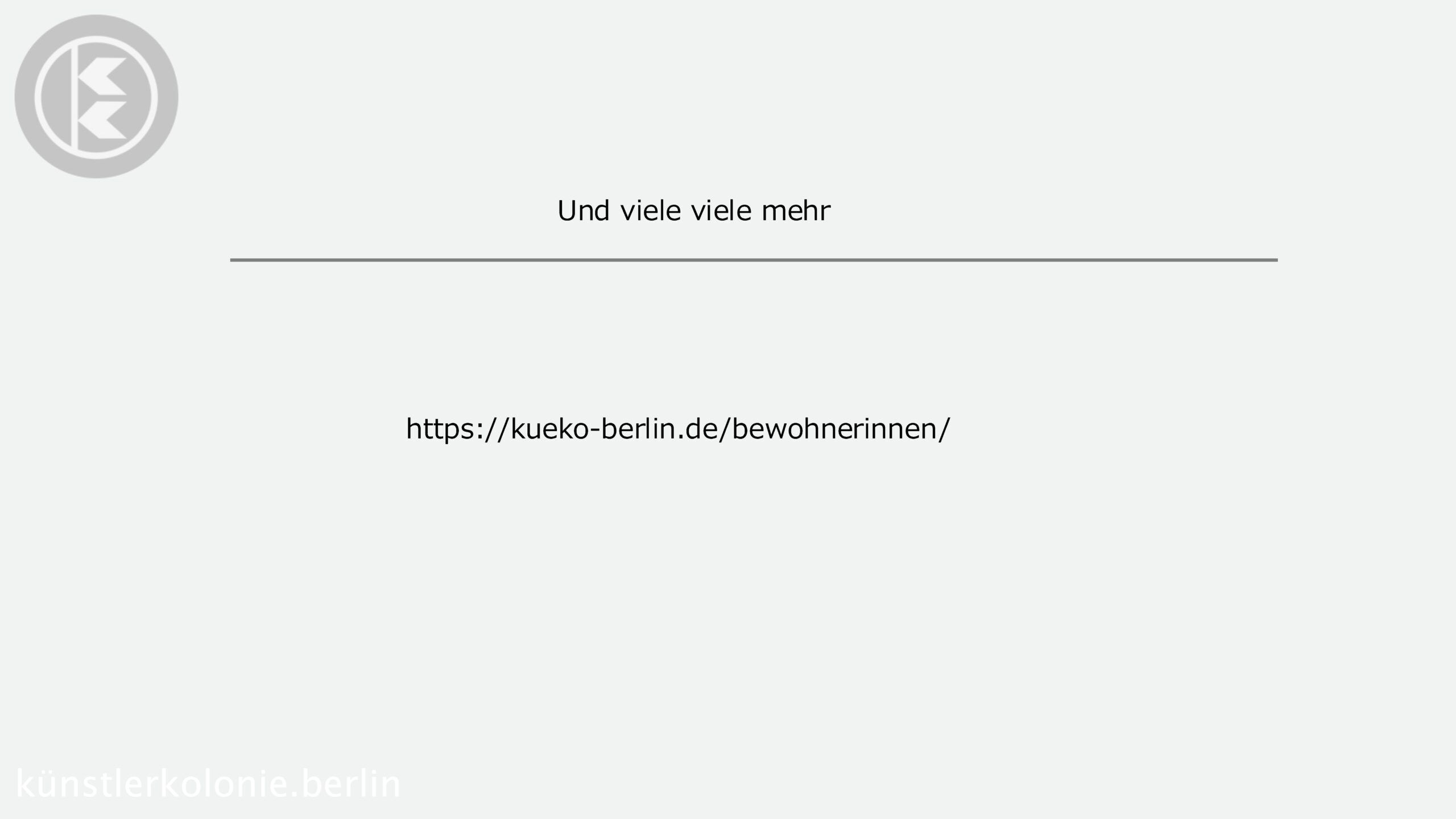Der Vergleich von Großstädten wird in der sozialwissenschaftlichen Stadtforschung genutzt, um Merkmale einer Stadt und der Stadtentwicklung zu identifizieren, die bei der Betrachtung einer einzelnen Stadt nicht erkennbar wären. Während es schon wenige Städtestudien zur Bedeutung der Kultur für die Stadtentwicklung gibt, so sind die städtevergleichenden Arbeiten zu dieser Thematik an einer Hand abzuzählen. Zu nennen sind hier ein Vergleich des kulturellen Konsums in Städten Skandinaviens, Großbritanniens, Polens, Bulgariens, Russlands, Portugals und Spaniens,[1] ein Vergleich der Kreativität von Städten,[2] eine Dokumentation der Bedeutung von Kunst und Kultur für die Entwicklung innerstädtischer Stadtgebiete in den USA,[3] eine Studie zur Bedeutung von Künstlerinnen und Künstlern bei Bürgerbeteiligungen in der Stadtentwicklung[4] und eine vergleichende Untersuchung der Konzentration von Künstlern in bestimmten Stadtgebieten US-amerikanischer Großstädte.[5] Die hier vorgenommene Untersuchung zur Bewertung und Wirkung von Kunst, Kultur und Künstlern auf die Stadtentwicklung stellt zwei Städte gegenüber: das US-amerikanische Baltimore und Hamburg. Dieser Vergleich findet seit mehr als zehn Jahren für Hamburg und seit mehr als zwanzig Jahren für Baltimore statt.
Die Hauptfrage lautet, wie Künstler, Kulturmanagerinnen, Stadtplaner und Kommunalpolitikerinnen Kunst und Kultur als Instrument der Stadtentwicklung verstehen, bewerten und einsetzen. Dies bezieht sich zum einen auf lokale Strukturen wie etwa der Einfluss von Kunst auf Nachbarschaften, und zum anderen auf größere Perspektiven wie die Wirkung überregional ausstrahlender Kulturstätten für eine postindustriell geprägte Stadtökonomie. Ich verwende dabei zwei Vergleichsperspektiven: den Raum (Vergleich von Baltimore und Hamburg) und die Zeit (Vergleich der Nutzung von Kunst und Kultur in den Jahren 1988, 2004 und 2010 für Baltimore). Diese Fragen werden mit Hilfe einer systematischen Inhaltsanalyse von 70 halbstrukturierten Experteninterviews beantwortet, die ich in Baltimore 1988, 2004 und 2010 und Hamburg 2006 und 2013 durchgeführt habe. Bei der systematischen Inhaltsanalyse handelt es sich um das mehrstufige Filtern häufig angesprochener Themen in Interviews, die Etikettierung dieser Themen als Codes und die Analyse der Überschneidung dieser Codes. Die Überschneidungen werden als semantische Relationen untersucht und in Netzwerkdarstellungen visualisiert.[6]
Baltimore und Hamburg bieten sich zum Vergleich an, da beide ältere, im 19. Jahrhundert industrialisierte große Hafenstädte sind, zugleich aber in den vergangenen 50 bis 70 Jahren unterschiedlich erfolgreich postindustrialisiert wurden. Als größte Metropolregion des US-Bundesstaates Maryland umfasst Baltimore knapp 2,7 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner, Hamburgs Metropolregion umfasst 5 Millionen Bewohner. Baltimore erlebte in den vergangenen 65 Jahren einen deutlichen Rückgang der innerstädtischen Bevölkerung von 950.000 (1950) auf 620.000 (2014) Bewohner, während Hamburg seine Bevölkerungszahl nahezu halten konnte (1965: 1.860.000, 2015: 1.770.000 Einwohner).[7] In beiden Städten spielt der Hafen eine große wirtschaftliche Rolle. Allerdings stagniert in Baltimore die Ansiedlung größerer Unternehmenszentralen: Hier meldeten 2003 eine große Schiffswerft und 2012 ein großes Stahlwerk Konkurs an. Hamburg zählt hingegen mit Airbus heute zu den weltweit größten Standorten der Luftfahrttechnik. Gleichzeitig ist Hamburg ein wichtiger nationaler Medienstandort. In Baltimore haben Suburbanisierung und Immobilienspekulation zu Segregation und Diskriminierung insbesondere der 67 Prozent Schwarzen innerstädtischen Bevölkerung geführt, mit der Folge einer hohen Rate an Analphabetismus, Armut und Drogensucht. Dagegen stellen sich die Probleme Hamburgs vergleichsweise gering dar, mit einer durch die wirtschaftliche Erfolgslage starken Zunahme der Lebenskosten und einer Gentrifizierung in innerstädtischen Stadtteilen sowie einer relativ deutlichen ethnischen und sozioökonomischen Segregation zwischen Zentrum und Peripherie.
Kunst und Kultur als Stadtentwicklungsfaktor
Die Deutung von Kunst und Kultur als Instrument der Stadtentwicklung ist in Baltimore über die Jahrzehnte alles andere als stabil. In den insgesamt 41 Interviews werden zwar einige Themen, die mit den Codes „Stadtkultur“, „Kulturförderung“, „städtische Ökonomie“ und „Netzwerk“ bezeichnet werden, immer wieder angerissen. Die Bedeutung dieser Konzepte hat sich aber im Laufe der Jahre deutlich verändert. So verstanden die 1988 interviewten Expertinnen und Experten unter „Netzwerk“ noch ein mächtiges und versteckt agierendes Netzwerk der wichtigsten städtischen Hochkulturinstitutionen – Kunstmuseen, Symphonieorchester, Oper, Stadt- und Musicaltheater –, die sicher aus den gleichmäßig fließenden jährlichen Zuschüssen aus Stadt und Bundesstaat schöpfen konnten. 2004 war das Netzwerk dagegen weitaus weniger hegemonial: Jetzt stand der Code für eine lockere Vereinigung vieler kleinerer und mittelgroßer städtischer und regionaler Kulturstätten, die sich in der Greater Baltimore Cultural Alliance zusammengetan haben. Diese informelle Vereinigung war nicht nur in der Lage, eine solidarische Stimme gegenüber den großen Akteuren der Kulturförderung zu erheben, sondern wurde auch von den wichtigsten Hochkultureinrichtungen akzeptiert, die ihre hegemoniale Position aufgaben. 2010 wurde dieses solidarische Netzwerk um ein weiteres Netzwerk einer lokalen, kulturfördernden Zivilgesellschaft ergänzt, die mit ihrer gemeinnützigen und außerstaatlichen Förderpolitik viele junge Künstler symbolisch und materiell unterstützte.
Die Veränderung der Konnotation des Begriffs „Netzwerk“ verweist auf eine zwischen 1988 und 2010 zunehmende demokratische Ausgestaltung von Kultur und Kunst. Ähnliches lässt sich auch hinsichtlich anderer Codes oder Themen sagen. Ende der 1980er Jahre drückten die Baltimorer Befragten noch deutlich den Wunsch aus, im Sinne Adornos die „ungebildeten Massen“ durch die Hochkultur zu „läutern“. Die Grenze zwischen Hoch- und Populärkultur wurde von den Experten deutlich ausgewiesen. So sagte der geschäftsführende Direktor des Baltimore Symphony Orchestra: „Die Leute in der Stadt wollen (klassische Konzerte) für ihre Kinder, auch wenn sie sie nicht für sich selbst wollen. Die Leute fühlen, dass klassische Musik eine wertvolle Erfahrung für ein gutes Leben (ist), und deshalb wollen sie ihren Kindern diese Gelegenheit geben, sich dieser Musik auszusetzen.“[8] In diesen Jahren diente Kunstkonsum der städtischen Kultur als erzieherisches Mittel zur sozialen Statuserhöhung. Ein ganz anderer, makroökonomischer Diskurs wurde dagegen 2004 verhandelt: Jetzt galt es mittels Kunst und Kultur „Kreativität“ in die Stadt zu bringen, um damit die Postindustrialisierung voranzutreiben. Um ältere Hafenrandgebiete als luxuriöse Wohn- und zum Teil Arbeitsgebiete umzugestalten, wurde nicht mehr nur die explizit „hoch“ genannte Kultur gefördert, sondern auch kleine Theaterbühnen, die informelle Musikszene sowie eine Mischung aus Restaurants, Bars, Cafés und Kunstorten. Dabei basierten die Expertenaussagen auf einer neuen Welle an Fachliteratur zur Bedeutung der Kreativität in postindustriellen Städten.[9]
Kreativität wurde ein schillernder, wenn auch unpräziser Begriff, der umfassend von Stadtpolitik und Wirtschaftsförderung verwendet wurde. So stellte 1999 der junge und tatkräftige Bürgermeister Martin O’Malley die Förderung einer „kreativen Klasse“ in den Mittelpunkt seiner neuen Politik. Er startete die Creative Baltimore Initiative als Idee, mit lokalen Künstlern auf Augenhöhe zu kooperieren, und wurde dabei von den örtlichen Kulturkreisen strategisch unterstützt. Als Ergebnis unterzeichneten der Bürgermeister und 79 lokale Künstler ein white paper, in dem die politische, soziale und wirtschaftliche Bedeutung der Künstler in der Stadt offiziell bestätigt wurde.[10] Der positive Einfluss des Ökonomen Richard Florida auf die städtische Kulturpolitik wurde immer wieder betont. Florida versteht die kulturelle und künstlerische Aufwertung innerstädtischer Stadtteile allein als Attraktion für die kreative Klasse wohlhabender und hochqualifizierter Neubewohner und nicht für junge, zumeist prekär lebende und künstlerisch nur potenziell interessante Künstler und Kulturschaffende. Ernüchternder, aber auch pragmatischer und realistischer, klangen die Expertenaussagen 2010. Vor allem die wichtigen gemeinnützigen Projektentwicklerinnen und -entwickler verstanden Kunst und Kultur nicht mehr als kurzfristiges Wundermittel zur wirtschaftlichen Rettung der Stadt. Vielmehr sahen sie darin ein kleinstufiges, langfristiges, mühseliges Mittel mit einer weniger klaren „Erfolgsquote“, um bestimmte Stadtgebiete durch eine zielgerichtete Wagnisförderung bisher unterschätzter kreativer Trends, Personen und Einrichtungen zu unterstützen. Von dieser unscheinbaren, weniger Politikpropaganda und Stadtmarketing bezweckenden, aber zielgerichteten Hilfe profitierten vor allem junge, sich selbst und ihre Kunst noch entdeckende Künstler.
Jetzt wurde sich klar von Floridas These distanziert. Die wichtigsten Vertreterinnen dieses alternativen Blickes auf Kunst- und Kulturproduktion in der Stadt sind Ann Markusen und Anne Gadwa, die Künstler und Kultur als essenziellen Teil des sogenannten placemaking verstehen.[11] Künstler und ihre alltäglichen Aktionsräume und Netzwerke werden hier als soziale Gewebe verstanden, die städtische Räume durch künstlerisches Wirken zu öffentlichen, inklusiven und zivilgesellschaftlichen Orten machen. Dafür müssen Künstler dort frei von wirtschaftlichen und anderen Ängsten arbeiten und leben können, also mit angemessenen und preiswerten Räumlichkeiten für ihre spezifische Arbeits- und Lebenssituation versorgt werden. Dies umfasst ein komplexes Aufgebot an Proben-, Aufführungs-, Ausstellungs- und Verkaufsräumen, die Bereitstellung von Förderungen, Stipendien und Weiterbildungsmöglichkeiten und die mit den Künstlern gemeinsam umgesetzte Ausgestaltung dieser Räume zu Orten intensiver Vernetzung.[12] Während der Diskurs 2004 noch politische Versprechungen einer umfassenden Stadt- und Wirtschaftsförderung produzierte, ging es um einen kleinteiligen, aber realisierbaren Pragmatismus für kleinere städtische Räume, die sich nicht zu weit von anderen, sich schon entwickelnden Stadtteilen befinden. Im Stadtteil Station North etwa standen für Jahrzehnte viele mehrstöckige Industriegebäude leer,[13] die nun zum Ziel dieses künstlerischen placemaking wurden.
Der Präsident der Stadtagentur Baltimore Development Corporation drückt dies so aus: „Die (darstellenden und bildenden Künstler) haben es selber initiiert, zunächst mit kleinen Gruppen, wir haben es dann unterstützt und jetzt ist es ein Selbstläufer. Also, all dies ist nicht ein großer Plan der Stadt oder von irgendwem anders gewesen, aber jetzt helfen wir wo wir können.“ Über die Zeit fanden also mindestens zwei große Transformationen statt: Während 1988 bei den Akteuren der Kultur- und Stadtentwicklung kein Bewusstsein für Kunst als Stadtentwicklungsfaktor bestand, das über Status- und Erziehungsfunktionen hinausging, wurde 2004 die ökonomische Funktion der Kultur als legitimierender Faktor im Sinne Floridas betont. 2010 stellte sich die Situation wiederum anders dar und die sozial und städtepolitisch stabilisierende Funktion von Künsten als Elemente des placemaking wurden betont.[14] Eine Gesetzmäßigkeit lässt sich mittels dieser Fallstudie natürlich nicht postulieren. Durch die Gegenüberstellung mit einer anderen Stadt lässt sich jedoch die „Eigenlogik“ verdeutlichen, also die städtisch spezifische Logik des Einsatzes von Kunst und Kultur in der Stadtentwicklung. Dies soll nun durch den Vergleich des Einsatzes von Kunst und Kultur in Baltimore 2004 und Hamburg 2006 geschehen. Ungeachtet der Einbettung in kapitalistische Systeme der nordwestlichen Hemisphäre sind die politischen Steuerungssysteme in beiden Städten so unterschiedlich, dass die Bedeutung von Kultur im urbanen Kontext davon intensiv beeinflusst wird. Als zentrale Aussage kann hier immer noch das Ergebnis einer nationalen Vergleichsstudie von 1996 angeführt werden:[15] In den USA findet demnach staatliche Kulturpolitik nur sehr indirekt statt, finanzielle Zuschüsse werden zuerst an kulturschaffende Peergroups vergeben, die dann die Verteilung nach selbst festgelegten Kriterien vornehmen. In Deutschland hingegen bleibt Kultur traditionell nicht nur eines der wichtigsten Einflussgebiete kommunaler Politik, sondern ist finanziell in großem Maße von staatlichen Quellen abhängig. So überrascht es nicht, dass die Gespräche mit den Hamburger Experten 2006 immer wieder zu einem Thema führten: „Kulturpolitik“. Diesem Thema folgten „Wirkungen der Kultur auf die Stadtentwicklung“, „Netzwerke“, „staatliche Finanzierung“ und „Kreativität“.
Das „Image der Stadt“ und die Wirkung der Kultur auf die „Stadtökonomie“ wurden weiter verbunden mit Themen wie „kulturelle Leuchttürme“, „Elbphilharmonie“ und „HafenCity“. Das offizielle Leitbild der „Wachsenden Stadt“ symbolisierte den Fokus auf das Ziel einer gesamtstädtischen ökonomischen Prosperität – weniger der Verteilungsgerechtigkeit –, und die interviewten Verantwortlichen der Kulturpolitik hatten sich diesem Ziel voll verschrieben. Hier gab und gibt es zwei große Projekte: zum einen die Entwicklung der „HafenCity“, die durch den Bau der „Elbphilharmonie“ und der Ansiedlung des internationalen Maritimen Museums und des Science Centers gezielt kulturell konnotiert wird; und zum anderen die Revitalisierung St. Paulis und benachbarter innerstädtischer Stadtteile, die im Sinne Floridas zu plug-and-play communities der kreativen Klasse umgebaut werden, mit gentrifizierten Wohngebieten, Start-Up Büros im Industrieschick der Gründerzeitästhetik und einem neuen Unterhaltungsviertel an der Reeperbahn für den breiteren Geschmack. „Im Prinzip waren die Reeperbahn und die ganze Gegend ziemlich runtergekommen“, so der damalige Stadtentwicklungssenator, „es war eigentlich nur noch schmuddelig.
Die Entwicklungen um (die Musicaltheater) ‚Schmidts Tivoli‘ und Operettenhaus waren dann zwei letztendlich private Ansätze, die dazu geführt haben, dass dort völlig andere Besucherströme hingekommen sind, die das Ganze völlig aufmischten, und dies hat letztendlich (…) zu einer völlig anderen optischen Wahrnehmung geführt. Das ist der Einfluss von Kultur auf Stadtentwicklung.“ Die Thesen Richard Floridas hinterließen sowohl in Baltimore wie in Hamburg ihre deutlichen Spuren. Kultur, Stadtökonomie und Kreativität bilden in beiden Städten ein festes Argumentationsdreieck. In Hamburg wird die Kultur als Teil der Stadtentwicklung allerdings weitaus stärker durch ihre Bedeutung für die Stadtökonomie legitimiert als in Baltimore. Der deutlichste Unterschied zwischen den Städten befindet sich in dem Größenmaßstab kultureller Projekte: Während in Hamburg mit kulturellen Leuchtturmprojekten und einem europäischen Stadtentwicklungsvorhaben im großen Maßstab geworben wird, stellt sich Baltimore nach außen pragmatischer, kleinteiliger und weniger PR-offensiv dar. Baltimores Unterstützung der Künstlerviertel hilft im kleinteiligen Maßstab vor allem den vielen weniger etablierten und (noch) nicht berühmten Künstlern. Hamburg versteht hingegen Hochkultur entweder als im globalen Maßstab zu bewerbendes Konsumprodukt oder als kommerzielle Aktivität wie zum Beispiel Musicals, mit der eine innerstädtische Reurbanisierung im Sinne Floridas vorangetrieben werden kann.
Macht der Kulturpolitik
Kultur als Teil der Stadtentwicklung muss nicht zwingend Aufgabe einer städtisch-staatlichen Kulturpolitik sein, wie der Vergleich mit Baltimore zeigt. Die Frage nach der Bedeutung der Kulturpolitik für die städtische Kulturentwicklung wurde in Baltimore zurückhaltend beantwortet. Zwar zeigte sich hier ein potenziell starker Einfluss des Bürgermeisters, wenn er denn in dieser Frage Statur zeigen möchte, aber die Selbstgestaltung urbaner Kultur durch zivilgesellschaftliche Netzwerke gewann in den vergangenen zwanzig Jahren zunehmend an Bedeutung. Der Einfluss der von Kultureinrichtungen und Künstlerinitiativen 2001 gegründete Greater Baltimore Cultural Alliance ist hier beispielgebend, wie es die damalige Vorsitzende Nancy Haragan darlegte. Nachdem der Bürgermeister Unterstützung signalisiert hatte, seien sie strategisch vorgegangen, mit dem Ziel, neue Wege zu gehen: „Wir luden einzelne Personen aus lokalen Künstlergruppen ein mitzumachen, denn die fühlen sich immer unterdrückt (…). Wir haben von Anfang an nicht auf die großen Kulturinstitutionen gesetzt, sondern auf die kleinen und die Künstler. Politisch war dies sehr wichtig, obwohl wir zuerst auch einen deutlichen Gegenwind spürten.“ Die Bedeutung von Stadtverwaltung und -politik für die Kulturgestaltung in Baltimore wird folglich als sehr gering eingeschätzt. Wieder Nancy Haragan: „Nachdem die alte Stadtregierung sich zurückzog, realisierten die Leute plötzlich, dass das Rathaus eigentlich für die Kultur dieser Stadt ohne Bedeutung war (…), dass man nicht die Erlaubnis des Rathauses braucht, um das zu tun was man für die Kultur tun muss (…). Wenn sie will, kann die Stadt dann immer noch später zu uns kommen und darum bitten, uns zu unterstützen.“
 Abbildung 1: Der Einfluss der Kulturpolitik auf die Bedeutung der Kultur für die Stadtentwicklung in Baltimore 2004 (© bpb)
Abbildung 1: Der Einfluss der Kulturpolitik auf die Bedeutung der Kultur für die Stadtentwicklung in Baltimore 2004 (© bpb)
Überlappungen der Themen „Kulturpolitik“, „gemeinnützige Netzwerke“, „Künstlerviertel“ und „Reurbanisierung“ beziehungsweise „positiver Stadtteilwandel“ in Baltimore werden in dem semantischen Netzwerk der Abbildung 1 deutlich. Der große Einfluss der städtisch-staatlichen Politik auf die Kultur und die kulturell orientierte Stadtentwicklung für Hamburg lässt sich im semantischen Netzwerk verdeutlichen (Abbildung 2). Die staatlichen Akteure sind dabei nicht nur die wichtigsten Gestalter kulturell orientierter Stadtentwicklung, sie werden ganz anders als in der basisdemokratischen Atmosphäre Baltimores parteipolitisch und durch Behördenvorgaben bestimmt.
 Abbildung 2: Der Einfluss der Kulturpolitik auf die Bedeutung der Kultur für die Stadtentwicklung in Hamburg 2006 (© bpb)
Abbildung 2: Der Einfluss der Kulturpolitik auf die Bedeutung der Kultur für die Stadtentwicklung in Hamburg 2006 (© bpb)
Diese deutliche Top-down-Orientierung ruft allerdings eine ebenso deutliche und kritische Reaktion der basisdemokratisch orientierten Kulturszenen hervor: So kritisiert etwa die damalige Sprecherin der Hamburger Echo Mailingliste für Kunst, Kritik und Kulturpolitik den Einfluss der Behörden und Parteien, deren Personal es häufig an kulturpolitischer Kompetenz mangele: „Zur Kulturpolitik gehört eben auch kompetentes Personal, also in den Behörden oder in den Parteien, die sich dann auch für das Metier interessieren.“ Kulturentscheidungen in Hamburg sind aber nicht immer allein Parteientscheidungen. Einige Entscheidungen – wie zur Elbphilharmonie oder zur Kreativgesellschaft – sind in parteiübergreifenden, manchmal Koalitionen entstammenden Verhandlungen entstanden.
Genauso wichtig sind die Behörden, die mit ihren Apparaten nicht nur Korrektive eines Legislaturperioden-Aktionismus sein können, sondern notwendige Veränderungen auch verhindern können, wie ein Kulturmanager eines nichtstädtischen Kulturzentrums beklagte: „Dieses traditionelle Ungleichgewicht der Hochkultur zu Ungunsten der alternativeren Kulturformen finde ich falsch. Und das müsste in meinen Augen – maßvoll – eine Kulturbehörde ändern können, (…) dann muss sich eben eine Verwaltung umstrukturieren und halt Leute integrieren können, die das verstehen was wir machen.“ In diesem Sinne wird die städtische Kulturpolitik als Sachverwalter des Status Quo samt einer ungerechten Verteilung verurteilt. Die Sprecherin des Echo Netzwerkes drückt ihre Frustration noch deutlicher aus: „Alles, was Kulturförderung ist, ist gebunden an einen bestimmten Stadtteil, an ein bestimmtes Thema oder an eine bestimmte Funktion, (…) die Förderung ganz freier Produktionen geht fast gegen Null. Und das finde ich sehr skandalös, weil es die allermeisten, eigentlich alle Künstler, betrifft, es aber keine Lobby dafür gibt, weil die einzelnen Künstler überhaupt nicht vernetzt sind.“
Allein der Geschäftsführer einer unabhängigen, kulturell engagierten Stadtplanungsagentur spricht hoffnungsvoll von der Möglichkeit einer zivilgesellschaftlichen Vernetzung Hamburger Künstlerszenen zur Verringerung ihrer staatlichen Abhängigkeiten: „In den neuen kulturellen Stadtteilinitiativen werden wir das jetzt selbst in die Hand nehmen. Wenn der Staat seine Gestaltungs- und Diktionsmacht aufgibt, dann können in diesem Vakuum Leute Räume schaffen, Möglichkeitsräume, und ihre Sachen machen, visuelle Kommunikation, Soziokultur, Stadtentwicklung, lebendige Stadt (…) und dann hoffen, dass eine leichte Kursveränderung einsetzt.“
Die Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe hat in ihrem Buch zur „Agonistik“[16] von der Polarität zwischen einer konflikt- und einer konsensbetonenden Politik gesprochen. Die Demokratie wird ihrer Meinung nach von der Betonung eines vermeintlich alternativlosen Konsenses bedroht. In diesem Sinne verschwindet der öffentliche Streit um Mittel und Ziele der Stadtkultur, er wird entpolitisiert und entdemokratisiert, weil er sich den alternativlosen Plänen der umfassenden ökonomischen Agenda eines „Unternehmens Hamburg“ unterordnen muss. Kulturpolitik in dieser Stadt ist aufgrund der immer noch großen städtischen Finanzressourcen staatlich stark determiniert, zum anderen führt dies zu einer Einengung der Kulturpolitik auf die Kulturfinanzierung. Diese kann wiederum nur durch ihre Kontextualisierung in wirtschaftlichen Zusammenhängen legitimiert werden, sei dies als Teil postindustrieller Kreativindustrien, als Annehmlichkeiten für die kreative Klasse oder als Leuchttürme des Stadtmarketings. Dieser vermeintlich unabwendbare Konsensus schließt andere Legitimierungen einer staatlichen Kulturpolitik zwar nicht aus, zum Beispiel der Beitrag der urbanen Kultur und ihrer Produzenten zu möglichen sozial, ökologisch oder kulturell nachhaltigen Stadtentwicklungen, er macht sie aber zu Marginalien politischer Entscheidungen. Eine agonistische Kulturpolitik könnte zu einer Redemokratisierung der Kulturgestaltung führen – und Ansätze sind dafür auch in Hamburg vorhanden.[17]
Weitaus anders stellt sich dagegen die Kulturpolitik in Baltimore dar. Zum einen machen fehlende städtische Ressourcen eine umfassende Einflussnahme der öffentlichen Hand unmöglich. Zum anderen sind die Erwartungen der Kulturschaffenden und Künstler an eine staatliche Unterstützung denkbar gering. Eine von der Zivilgesellschaft bestimmte Kultur- und Stadtentwicklungspolitik hat mittels mächtiger und reicher Stiftungen und anderer gemeinnütziger Institutionen – etwa Universitäten und Hochschulen – eine besondere Verantwortung, die sie im Dialog mit Künstlern und zivilgesellschaftlichen Vereinigungen umsetzt. Politik und Verwaltung sowie kommerzielle Projektentwickler halten sich nach Aussagen des damaligen Präsidenten der örtlichen Kunsthochschule im Hintergrund, weil Baltimore den „Vorteil“ habe, wirtschaftlich nicht auf der Sonnenseite zu stehen. Dies habe nämlich erst eine von der Marktlogik befreite, kulturell motivierte Stadtentwicklung möglich gemacht: „Man kann Räume für Künstler, Studios und selbst Kunstgewerbe hier nicht richtig profitabel machen. Was macht man dann? Man findet gemeinnützige Einrichtungen, die es eben in Baltimore gibt, und baut mit deren Hilfe diese Fabrikgebäude um (…), ohne dass daraus ökonomische Gewinne, aber sehr wohl soziale Gewinne, Bildung und eine Steigerung von Lebensqualität in diesem Viertel zu erzielen sind.“ Die ökonomische Malaise Baltimores beherbergt für Künstler und Kulturproduzenten den Gewinn, nicht mit ökonomisch mächtigeren Akteuren im Wettbewerb um Räumlichkeiten zu stehen; es besteht kein Marktdruck. Ein interviewter Künstler drückt dies so aus: „Die Kunstszene in Baltimore ist immer durch die Künstler gestaltet worden, nicht durch die Galerien oder Museen. Die Künstler können hier die Welt so gestalten, wie sie es gerne haben wollen.“
Die Antithese findet sich in Statements einer Intendantin eines Privattheaters in einem der gentrifizierten Gebiete Hamburgs: „In unserem Stadtteil ist aus einer Industriebrache ein urbanes Zentrum geworden, wo sich viele kulturelle Einrichtungen, viel kulturelles Kleingewerbe angesiedelt hat, mit vielen weichen Standortfaktoren (…). Die Kulturpolitik hat dabei mehrere Probleme. Zum ersten machen wir nur Leuchtturmprojekte, die werden vor allem woanders wahrgenommen (…) und das Geld fließt dann immer nur an die Großen (…). Zum anderen wird immer nur betont, dass Kultur Geld bringt, gerade in so einer Pfeffersackstadt (…). Und zum dritten zahlen wir eine sehr teure Miete hier, weil wir in diesem nun schicken Stadtteil sind. Da muss sich sicherlich etwas ändern. Und alles fließt in die wunderbare HafenCity (…). Wo haben wir dann noch einen Freiraum, der sich selbst entwickeln kann?“
Fazit
Der Einfluss langfristiger Gouvernementalitätsstrukturen, die auf den Haushalt basierende Macht der Kulturpolitik und die daraus resultierenden Folgen für die Künstler und Kulturinstitutionen werden durch den Vergleich deutlich. Laut dem Kulturwissenschaftler Andreas Reckwitz kann man die Förderung künstlerisch-kultureller Kreativität in zwei Typen aufteilen: in urbane Steuerungen erster und zweiter Ordnung.[18]
Eine Steuerung erster Ordnung ist ein hierarchisch organisiertes, von oben herab festgelegtes Planungsregime, das vorrangig auf einer positivistisch-ontologischen Logik beruht. Zunächst werden an der Politikspitze Probleme der Stadt erkannt und festgelegt, dann werden dafür Lösungsstrategien gefunden, die dann Punkt für Punkt um- beziehungsweise durchgesetzt werden. Hamburgs Kulturpolitik kann diesem Typus zugeordnet werden.
Dagegen kommt eine urbane Steuerung zweiter Ordnung ohne diese a priori Planung aus. Hier kommen die Ideen nicht von oben; stattdessen nehmen die Politik und Verwaltung aufmerksam schon vorhandene Entwicklungen an der künstlerisch-kulturellen Basis wahr und fördern sie dann grundsätzlich. Eine solchermaßen handelnde Politik und Verwaltung nutzt selbstregierende zivilgesellschaftliche Regime der Basis und unterstützt sie in der Umsetzung ihrer Ziele.
Aber selbst diese Steuerung eigenständiger Kreativität ist in Baltimore nicht wichtig. Deshalb ergänze ich die der Perspektive des Kontinentaleuropäers Reckwitz entspringende Typologie um eine Steuerung dritter Ordnung, die besser zur US-amerikanischen Tradition eines gouvernementalen laissez-faire passt: die Abwesenheit städtisch-staatlicher Interventionen bei der Entwicklung kultureller Strukturen. Für Baltimore gilt, dass dieses Heraushalten – mit Ausnahme einer symbolischen Unterstützung als Teil einer Steuerung zweiter Ordnung – der künstlerisch-kreativen Entwicklung gut getan hat. Die staatliche kulturelle Interventionspolitik in Hamburg scheint dagegen der Entwicklung mainstreamferner und auch risikoreicher künstlerischer Kreativität abträglich zu sein.










 Abbildung 1: Der Einfluss der Kulturpolitik auf die Bedeutung der Kultur für die Stadtentwicklung in Baltimore 2004 (© bpb)
Abbildung 1: Der Einfluss der Kulturpolitik auf die Bedeutung der Kultur für die Stadtentwicklung in Baltimore 2004 (© bpb) Abbildung 2: Der Einfluss der Kulturpolitik auf die Bedeutung der Kultur für die Stadtentwicklung in Hamburg 2006 (© bpb)
Abbildung 2: Der Einfluss der Kulturpolitik auf die Bedeutung der Kultur für die Stadtentwicklung in Hamburg 2006 (© bpb)